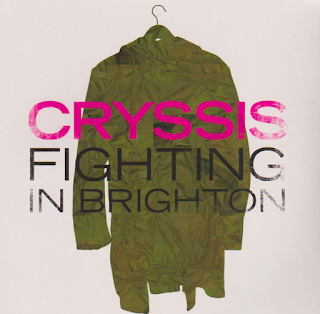Die junge Frau stapfte auf mich zu, das Gesicht zu einer Grimasse verzogen; sie sah echt wütend aus. »Und das da ...« Mit einem Ruck riss sie ihren Kopf herum, nickte so zur Bühne hinüber. »Das da oben ... das soll etwa Punk sein?«
Ich lachte auf. Auf der Bühne standen die Stranglers, wir hatten den 21. Juli 2001, und rings um uns bewegten sich die Massen von »Das Fest« in Karlsruhe. Irgendein Horst in der Riege der Veranstalter war auf die Idee gekommen, den Abend als »British Night« anzukündigen, und nun spielten zu vorgerückter Stunde eben die Stranglers.
»Also ..« Ich versuchte es ganz vorsichtig. Mir war klar, dass ich gut doppelt so alt war wie die junge Frau mit ihrem feuerrot gefärbten Haaren. Mit meinen sehr kurzen Haaren, dem Spermbirds-Shirt und der kurzen Hose sah ich auch nicht gerade »punkig« aus – aber wir standen in der gleichen Gruppe aus Punks, Ex-Punks und artverwandten Leuten zusammen. Ich wusste von ihr immerhin, dass sie seit einiger Zeit meine Radiosendung hörte und zumindest meine Stimme kannte.
»Das da oben ist natürlich kein Punk«, sagte ich, »aber es sind die Stranglers, und die waren damals irgendwie dabei, und deshalb werden sie immer in die Punkrock-Schublade gesteckt.« Ich wies auf die Musiker, die auf der Bühne standen und sich kaum bewegten. »Heute sind das alte Männer, die halt die Hits von früher spielen. Und wenn sie etwas bringen, das neuer als 1980 ist, meckern andere alte Säcke wie ich, dass sie den neumodischen Kram lassen sollen.«
Kopfschüttelnd blieb sie neben mir stehen. Ich mochte die Band, hatte sie schon in den späten 70er-Jahren gern gehört. »Black And White« hielt ich für eine richtig gute Platte aus jener Zeit, aber ansonsten waren die Stranglers eher eine Wave-Band gewesen, und mittlerweile würde man sie womöglich als IndieRock bezeichnen. Die Band hatte es »vor Punk« gegeben, und sie machte danach weiter.
Ich freute mich, wenn ich die alten Stücke hörte. Die Band hatte ich nie live gesehen, und ich fand es klasse, sie endlich auf einer Konzertbühne zu erleben. Und ein Stück wie »Golden Brown«, meilenweit, ach was, lichtjahreweit entfernt von allem, was auch nur ansatzweise Punk war, gefiel mir nach all den Jahren immer noch.
»Hey!«, rief ich auf einmal aus. »Das hier ist jetzt aber Punk.« Und dann setzte ich kleinlaut hinzu. »Zumindest haben wir so etwas früher als Punkrock bezeichnet.«
Die Band stimmte »No More Heroes« an. Automatisch fing ich an, mit dem Fuß mitzuwippen. Einige Langhaarige in unserer Nähe fingen an, begeistert mitzusingen. Entsetzt starrte mich die junge Frau mit den roten Haaren an.
Ich hatte das Gefühl, das Stück sei langsamer auf der Platte, und von der Energie, die ich in dem Stück immer gesehen und gehört hatte, schien auf einmal nichts übrig geblieben zu sein. Wenn ich in Gedanken die Augen schloss, sah ich mich aber selbst, wie ich 1978 oder 1979 das Stück zum ersten Mal im Jugendzentrum hörte und davon begeistert war. Die Erinnerung überlagerte für einige Momente das tatsächliche Stück.
Noch einmal starrte mich die Rothaarige an. Dann schüttelte sie den Kopf und ging einige Meter zur Seite, zu einer Gruppe von jungen Punks, die sich zwar in unserer Nähe abhielten, aber eine gewisse Distanz behielten. Sie murmelte etwas vor sich hin, das ich nicht verstehen konnte.
Ich war sicher, dass es so etwas wie »alte Männer« war und mit einer gewissen Verachtung ausgesprochen wurde. Und ich konnte sie irgendwie verstehen.