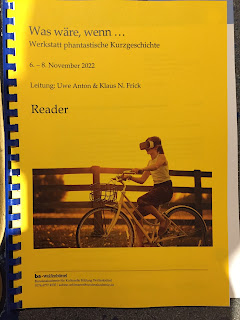Es passiert einiges um mich herum, und nicht alles gefällt mir. Vieles fasziniert mich, vieles interessiert mich – und das soll Thema dieses Blogs sein.
30 November 2022
Ein Kaffee in den Bergen
An den Tischen in meiner Nähe saßen andere Menschen, viele trugen Funktionskleidung und Wanderschuhe. Man sah ihnen an, dass sie von einer Tour zurückkamen oder zu einer Tour aufbrechen wollten. Sie wirkten frisch und unterhielten sich in unterschiedlichen Sprachen, von denen ich kein Wort verstand. Ihre Stimmen wurden zu einem unaufhörlichen Brummen und Brausen in der Nähe, das mein Ohr erfüllte.
Auf einmal schrien einige auf. Glässer klirrten, Besteck schepperte, Menschen sprangen an die Brüstung des Balkons. Ich folgte ihrem Blick und erhob mich ebenfalls.
Auf der anderen Seite des schmalen Gebirgstals geriet eine Geröllhalde ins Rutschen. Tausende von Steinen setzten sich in Bewegung, rumpelten mit einer enormen Wucht ins Tal. Bäume splitterten unter der Wucht, Staub stieg in Rauchschwaden in die Höhe.
Und das Rumpeln hörte nicht auf, immer mehr Geröll rutschte. Wo kam das alles her, und wieso hörte es nicht einfach auf?
In diesem Moment merkte ich, dass der Boden unter mir wackelte. Das Hotel schwankte, während das Dröhnen des Gerölls immer lauter wurde und mich der Staub einhüllte. Da wachte ich auf.
Späte Aufklärung eines fiesen Dramas
In einem Schrankkoffer wird die Leiche eines 16 Jahre alten Mädchens gefunden; der Mord liegt einige Jahre zurück. In drückender Hitze muss die Polizei ermitteln; Spuren gibt es nur wenige, und viele Beteiligte halten den Mund. Schnell verdächtigt man einen bekannten Mitbürger, aber es mangelt an Beweisen. Commissario Montalbano, der den Mord immer persönlicher nimmt, beginnt mit einem riskanten Spiel …
In seinen Romanen um den Ermittler Montalbano geht Andrea Camilleri selten den einfachen Weg. Häufig lässt er seine Romane ganz locker beginnen, führt die Figuren ein, erzählt ein wenig vom Drumherum, um dann nach einiger Zeit mit den fiesen Szenen zu kommen. Das ist bei diesem Roman nicht anders.
Vor allem am Anfang geht es um den Sommer und um Beziehungen. Eingebettet ist alles in eine familiär-lustige Geschichte, die nebenbei verrät, wie in Sizilien der Hausbau betrieben wird – da wird halt auch mal beinhart betrogen und auf eine Amnestie gehofft. Dann schmeißt sich eine unglaublich attraktive junge Frau an den Commissario ran, und es dauert seine Zeit, bis der Autor seinen Lesern einige Zusammenhänge darlegt.
Letztlich kommt »Die schwarze Seele des Sommers« nicht ganz ohne die Mafia und ihre Machenschaften aus. Aber vor allem ist es ein Krimi, in dem es um menschliche Verfehlungen und Niedertracht geht.
Dass am Ende ein frustrierter Montalbano zurückbleibt, passt nicht so ganz zum Klischee eines gemütlichen Romans, macht die packende Geschichte irgendwie aber sehr »rund« …
29 November 2022
Bekannte Autorin, von mir vergessen
So hatte ich die Autorin Maria W. Peter nicht richtig auf dem Schirm. Ich hatte ihren Namen zwar wahrgenommen, mich aber nicht mit ihren Romanen beschäftigt. Wir sind sogar via Facebook miteinander »befreundet« – aber ich war nicht in der Lage, die richtigen Informationen im Kopf zusammenzufügen.
In der Ausgabe 115 des Fanzines »Paradise«, das schon im April 2022 erschienen war, die ich aber erst dieser Tage las, stolperte ich über einen Artikel über die Autorin. Verblüfft stellte ich fest, dass ich sie tatsächlich kenne. Oder zumindest einmal kannte … Es waren Bilder abgedruckt, die Maria W. Peter in den 90er-Jahren kannte, und da wurde es mir wieder bewusst.
Sie war in dieser Zeit als junge Frau in der Fan-Szene aktiv, hatte Cons in Sinzig und Dortmund besucht und auch aktiv an diesen mitgewirkt. Danach ließ sie die Szene offensichtlich hinter sich, hielt aber den Kontakt zu einigen Leuten. Und mittlerweile ist sie eine Autorin, die in verschiedenen Verlagen veröffentlicht und deren Werk sich sehen lassen kann.
Verblüfft stellte ich bei der Lektüre des Artikels fest, wie viele Details mir dann doch wieder einfielen. Die Science-Fiction-Treffen in Sinzig und Dortmund kamen mir plastisch ins Bewusstsein zurück. Vielleicht sollte ich mal einen der historischen Romane von Maria W. Peter lesen.
Witziger Western-Comic mit ernsthaftem Thema
Ein schönes Beispiel hierfür ist »Fackeln im Baumwollfeld«, das hierzulande als Band 99 der »Lucky Luke«-Reihe erschienen ist. Das Cover zeigt schon die inhaltliche Richtung an: Lucky Luke und ein schwarzer Sheriff in einem Baumwollfeld, während im Hintergrund der Ku-Klux-Klan aufmarschiert.
Damit ist die Geschichte schon gut umrissen. Der Cowboy aus dem Wilden Western erbt eine Baumwollplantage in Louisiana. Die dort lebenden Weißen erhoffen sich von ihm Unterstützung, und die schwarzen Arbeiter sind verblüfft, als Luke ihnen helfen möchte, zu ihren Rechten zu gelangen.
Die erneute Unterdrückung der Schwarzen nach ihrer Befreiung in den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts wird in diesem Comic ebenso thematisiert wie das Aufmarschieren der Rassisten, die sich im Ku-Klux-Klan organisierten. Das geschieht natürlich in witzigen Szenen, die dennoch die politischen Inhalte klar benennen – das ist ein Comic, den Kinder sehr wohl konsumieren können, der sich aber vor allem an das mittlerweile mehrheitlich erwachsene Publikum richtet.
Jul schreibt gute Dialoge, Achdé zeichnet im klassischen Stil, der die Serie seit vielen Jahrzehnten prägt. »Fackeln im Baumwollfeld« ist somit eine gelungene Comic-Geschichte, die wunderbar unterhält und quasi nebenbei politisch-gesellschaftliche Inhalte vermittelt. Und ganz nebenbei klarstellt, dass der Wilde Westen nicht ganz so weißhäutig war, wie man gemeinhin glaubt …
28 November 2022
Auf ein neues 182,5
Der Titel hat eine innere Logik: »182,5« bezieht sich auf ein halbes Jahr, und gemeint ist das Programm von Januar bis Juni 2023. Die einzelnen Programmbereiche stellen sich vor. Es gibt ja nicht nur Literatur in Wolfenbüttel, wenngleich ich eigentlich nur diesen Programmbereich wahrnehme, sondern ebenso Bildende Kunst (da würde mich ein Seminar über NFTs glatt interessieren), Darstellende Kunst, Kulturmanagemnt, Musik oder Museum.
Es werden spannende Seminare kurz angerissen und relevante Menschen vorgestellt. Auf diese Weise werden mir unterschiedliche Bereiche der Akademie vermittelt. Solche Einblicke schätze ich.
25 November 2022
Im Schlosscafé
Wir hielten uns in Öhringen auf, einer kleinen Stadt im nördlichen Baden-Württemberg. Mehrfach war ich in all den Jahren an der Autobahn daran vorbeigefahren, aber an diesem Tag hatte es sich ergeben, dass wir durch die Stadt bummelten, uns an den schönen alten Häusern und dem wunderschönen Park erfreuten. Zum Abschluss des Sommerspaziergangs bot es sich an, im Schlosscafé Nussknacker ein wenig zu pausieren.
Der laut sprechende Mann war schätzungsweise fünfzig Jahre alt. Er saß mit zwei Jugendlichen und einer Frau in seinem Alter an seinem Tisch, dazu kamen eine Frau und ein Mann, beide um die dreißig; es sah so aus, als habe man sich zu einem Familienausflug getroffen. Sie taten das, was die meisten Menschen auf der Terrasse taten: Sie tranken Kaffee, sie aßen Kuchen, sie genossen den warmen Sonnentag.
Mit dem einen Unterschied, dass der Mann im dunkelblauen Hemd alle anderen Leute auf der Terrasse an seinem Wissen und an seiner Meinung teilhaben ließ.
»Der ländliche Raum …« Jedes Wort sprach er aus, als sollte der Spott daraus tropfen. »Also auf dem Land ist ja vieles einfach hinterwäldlerisch, aber hier gibt es halt noch echte Schafferle.« Er hob seine Tasse an. »Klar, der Kaffee kommt nicht von hier, aber sie kriegen ihn besser hin als bei uns an der Alster.«
Spätestens ab diesem Satz wusste jeder auf der Terrasse, woher die Familie kam: Leute aus Hamburg, die es – aus welchen Gründen auch immer – in die schwäbische Kleinstadt verschlagen hatte. Sprach der Mann so laut, weil er es immer tat, oder hatte er eine laute Stimme, weil er wollte, dass ihn alle Leute in der Nachbarschaft verstanden? Ich wusste es nicht.
»Und Kuchen können sie auch«, fügte er hinzu. »Das alles ist richtig billig.«
»Preiswert heißt das, Schatz«, wandte die Frau ein, die neben ihm saß. »Billig ist abwertend.«
»Pah! Billig, preiswert, was auch immer. Wir sind doch hier bei den Schwaben, die sind doch sparsam, da werden sie bei so etwas keinen Stress machen.«
In der Tour ging es weiter. Wir unterhielten uns an unserem Tisch eher leise, um die anderen Leute nicht zu stören, hielten dann aber inne und hörten lieber dem Mann aus Hamburg zu. Er war laut, er war streckenweise beleidigend, und er sprach so laut, dass ihn jeder Mensch problemlos verstehen konnte.
Was er sagte, war nicht so wichtig. Er sprach über Kaffee und Kuchen mit derselben Bestimmtheit wie über Kindererziehung, das Wetter und die Politik der aktuellen Bundesregierung. Es gab kein Thema, zu dem er sich nicht klar und deutlich äußern konnte. Ab und zu sagte eine andere Person am Tisch etwas, eher ein Kommentar als eine Erwiderung, aber es blieben stets leise formulierte und zurückhaltende Ausnahmen. Ich ignorierte ihn irgendwann, und die Silben, die er von sich gab, verschmolzen in meinem Kopf zu einem lauten Brummen, das ich gut ausblenden konnte.
Als wir zahlten und gingen, redete der Mann immer noch. Wir gingen durch das Schlosscafé hinaus ins Freie. Dort hörten wir ihn dann wirklich nicht mehr, und ich atmete auf.
»So ein Schwätzer!«, sagte ich grimmig. »Der hörte ja gar nicht mehr auf.«
»Du hast aber auch die Klappe gehalten und dich nicht gegen sein Gerede verwehrt«, sagte meine Begleitung. »Du hättest ihm widersprechen können.«
»Dann hätten wir einen Streit gehabt.«
»Oder auch nicht. Wir wissen’s nicht, und wir werden’s nie erfahren.« Sie musterte mich kritisch. »Ist’s ein Fehler, sich zurückzuhalten und still zu bleiben, oder ist’s ein Fehler, einen Streit zu provozieren? Was ist feige, was ist mutig, was ist richtig?«
Ich runzelte die Stirn. »Das setzen wir jetzt aber nicht fort, oder?«
»Du kannst ja zurückgehen und den freundlichen Mann fragen, welchen Rat er für dich hätte.« Sie grinste. »Ich bin sicher, dass er sich zu dem Thema auch laut und deutlich äußern würde.«
Ich verdrehte die Augen. Selbstverständlich drehte ich nicht um, und ebenso selbstverständlich ging ich nicht in das Café zurück.
Bei einem weiteren Rundgang stellte sich heraus, dass Öhringen einige echt schöne Flecken aufwies. In meinem Ohr blieb aber die Stimme des laut sprechenden Mannes aus Hamburg. Es gibt Eindrücke, die einfach alles andere überlagern …
24 November 2022
Paranoia von der Oder
Dabei war die Band nicht schlecht: drei sehr kurzhaarige Jungmänner und ein Schlagzeuger mit Iro machten ihre Art von Oi!-Punk, die in zehn Stücken und einem Intro auf Platte gebracht wurde. Das war dann durchaus mal schrammelig, meist aber melodisch-rockig mit recht viel Energie.
Klar ist das Deutschpunk, meinetwegen Oi!-Punk, wie man das schon tausende Male zu hören bekommen hat – aber anhören kann ich mir das trotzdem gern. Zwischendurch wird mal ein hübscher Offbeat dazwischen gehauen, ansonsten gibt es einfach ordentlichen Punkrock mit Melodie und Schmackes.
2010 wurde die Platte veröffentlicht. Verantwortlich dafür war das kleine Label SN-Punx aus Schwerin, das sich leider auch schon spurlos aufgelöst hat. In einem Meer von rechtsoffenen Bands, die in derselben musikalischen Richtung unterwegs waren, erweist sich Paranoia als positives Licht.
»Ich sitze hier im Schein der Kerze / bin gerade aufgewacht / es plagen mich wieder die Ängste / sie haben mich gerade wach gemacht« – so singt die Band in dem Stück »Alptraum«, das fast einen Emo-Charakter hat, was den Text angeht. Klar gibt es auf der Platte auch die üblichen Sauflieder, die meisten Texte sind aber eher nachdenklich: Man wünscht sich, nach Jamaika abzuhauen, man denkt an verschollene Freunde oder an einen Ort, den es vielleicht gar nicht gibt.
Paranoia war sicher keine Band, die über den engeren Horizont der Oi!-Punk-Szene hinaus von Bedeutung war. Aber die Platte »Stich ins Herz« erweist sich beim wiederholten Anhören als erstaunlich gelungen!
23 November 2022
Zwei Nächte in Marseille
Mit dem Roman »Drei Uhr morgens« legt er aber ein Werk vor, das so gar nichts von einem Krimi hat. Im Prinzip geht es um einen Vater und einen Sohn, die in Marseille auf einer ungewöhnlichen Reise zur Selbsterfahrung sind. Die ruhig erzählte Geschichte zog mich bei der Lektüre immer mehr in ihren Bann – sie ist spannend, ohne auch nur ansatzweise Krimi-Aspekte oder dergleichen aufzuweisen.
Hintergrund für alles ist eine Epilepsie, die bei dem Sohn diagnostiziert wurde. Weil die Spezialisten für diese Krankheit in Marseille sitzen, reisen Vater und Sohn dorthin. Dort muss der Sohn an einem Experiment teilnehmen, das die Ärzte anordnen: Dazu gehört, dass er zwei Tage und zwei Nächte ohne Schlaf verbringen muss. Sein Vater beschließt, diese Zeit mit ihm zu teilen, was letztlich bedeutet, dass sie sich gegenseitig wachhalten müssen.
Daraus könnte man eine Klamotte machen, einen skurrilen Roman mit vielen schrägen Begegnungen. Der Autor verzichtet darauf. Er erzählt in einem ruhigen Ton, wie der Jugendliche mit seinem Vater diese Zeit verbringt. Die beiden trinken irrsinnig viel Kaffee, sie gehen stundenlang durch die nächtlichen Straßen, und sie reden.
Das könnte man elend langweilig erzählen, aber der Autor kann halt schreiben. Die Spannungen zwischen Vater und Sohn, die Begegnungen mit anderen Leuten, die Angst vor der Krankheit, das alles vermengt er in einem Erzählreigen, der fasziniert.
»Drei Uhr morgens« ist ein stiller literarischer Roman, der sich leicht lesen lässt und der im Leser nachwirkt. Zwischen all der Genre-Literatur, die ich ansonsten bevorzuge, ist das eine gelungene Abwechslung.
22 November 2022
Schroffe Zeichnungen, starke Geschichte
Erzählt wird von einem elf Jahre alten Mädchen, das ziemlich seltsam ist – im Comic wird sie auch mit Hasenohren dargestellt, mehr symbolisch gemeint natürlich – und sich in jeglicher Hinsicht von seinen Klassenkameradinnen unterscheidet. Das Mädchen spielt gern Dungeons & Dragons, langweilt sich in der Schule, findet die meisten Leute ziemlich bescheuert und streitet sich ständig mit der großen Schwester, die offensichtlich den Haushalt daheim am Laufen hält. Vor allem aber ist das Mädchen der Ansicht, es müsse Riesen töten und sei dafür besonders gut ausgerüstet
Der Comic zeigt das Mädchen, wie es in der Schule aneckt. Lehrer und Psychologen verzweifeln, die Schwester hat bei ihm keine Chance, und eine mögliche Freundin versucht alles, um an das Mädchen heranzukommen. Und alle gehen davon aus, dass das mit den Riesen nur eingebildet ist. Aber dann tritt doch ein Riese auf, und es kommt zu einer verheerenden Schlacht am Ufer des Meeres …
Das klingt vielleicht seltsam und verwirrend. Ich kann nur dazu auffordern, die Leseprobe auf der Internet-Seite des Splitter-Verlags anzuschauen. »I Kill Giants« ist großartig erzählt: Joe Kelly geht als Autor tief in die Psyche des Kindes und zeigt seine Denkweise. Das ist nicht lustig, das ist sehr ernsthaft, und am Ende sitzt man da und möchte heulen.
Künstlerisch ist das nicht immer meine Tasse Bier. Ken Niimura hat einen unglaublich schroffen Stil. Seine Schwarzweißbilder sind wirklich krass; sie sehen aus wie eine Mischung aus überdrehter Manga-Ästhetik und knallharter Science-Fiction-Action. Aber wenn man sich auf die Geschichte einlässt, stellt man fest, wie gut die Bilder und der Text zusammenpassen.
Großartiger Comic! Unbedingt ansehen!
21 November 2022
Die Künstliche Intelligenz im Zentrum
Aus diesem Grund waren wir beide zu einer Veranstaltung nach Reutlingen eingeladen. Sie fand am Freitag, 18. November 2022, in den Räumen des »Innoport« statt, eines Veranstaltungszentrums, das mit einer Rakete als Logo schon optimal für Science-Fiction-Leute wie uns gedacht war.
Ich brauchte eine Weile, bis ich das Gelände fand. Ein »Navi« im Auto ist wenig hilfreich, wenn man sich durch ein Gewirr von Baustellen bewegt. Letztlich folgte ich nicht mehr dem Pfeil, den mir die Navigation vorgab, sondern nutzte die Straßenkarte, die im »Navi« zu sehen war. Und nachdem ich ein »Durchfahrt verboten«-Schild ignoriert hatte, um dann erst zu sehen, dass darunter auch »Innoport« stand, fand ich auch schon das Gelände.
Bevor die Veranstaltung losging, verlaberte ich mich ziemlich gründlich. Die Leute vor Ort waren alle nett und kompetent, und so hatten wir einen Teil der Argumente schon ausgetauscht, als die Veranstaltung losging. Sie war leider schlecht besucht, mit den Veranstaltern war es gerade mal ein Dutzend Leute. Aber gut …
Prof. Dr. Jochen Orso von der Hochschule übernahm die Moderation und führte in das Thema ein, dann stellten sich Carsten Schmitt und ich kurz vor, bevor der Autor mit seiner Lesung begann. Er hatte extra für diesen Auftritt »Wagners Stimme« eingekürzt, was der starken Geschichte nichts von ihrer erzählerischen Wirkung nahm.
Danach begann ein munteres Gespräch, in dem es um Künstliche Intelligenzen im Allgemeinen ging, um den Segen und den Fluch der modernen Welt, eine positive oder negative Sicht auf die Zukunft oder – ganz allgemein – um die Schwäche der deutschsprachigen Science Fiction. Nach Ende der Veranstaltung wurde am Büchertisch noch weiter diskutiert, so dass ich erst gegen 22 Uhr loskam und kurz vor Mitternacht wieder daheim war.
Ein Überraschungs-Menü
Am gestrigen Sonntag waren wir wieder einmal dort. Es wurde ein Überraschungs-Menü angeboten, und wir aßen es – allerdings ohne die komplette Weinbegleitung. Die Abbildung der beiden Speisekarten genügt hoffentlich. Ich fand's wieder großartig und freue mich auf die nächsten Menü-Abende in dem Lokal.
(Nicht nur das Essen ist super. Ich mag auch die Leute, die dort arbeiten, und ich kenne auch immer einige der Gäste. Das liegt an der direkten Nachbarschaft; nebendran ist die »Mika«, eine selbstverwaltete Wohnungsgenossenschaft.)
18 November 2022
Ein Geheimagent und eine Schulklasse
Heute war der bundesweite Vorlesetag, und ich nahm wieder daran teil. In den vergangenen zwei Jahren hatte die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass ich Veranstaltungen dieser Art mied oder sie sogar untersagt waren. Heute trauten wir uns das alles wieder einmal.
Ich hatte einige Bücher und Heftromane mitgebracht, um den Kindern von meiner Arbeit zu erzählen. Es wurden Fragen gestellt, die sich auf das Weltall und Astronauten bezogen. Ein Mädchen, das als Berufswunsch angab, selbst einmal Astronautin zu werden, kannte sich sehr gut aus, ebenso ein Junge, der Wörter wie »Atmosphäre« oder »Internationale Raumstation« völlig selbstverständlich über die Lippen brachte.
Bei den Fragen konzentrierten sich die Kinder schnell auf die Dinge, die sie offenbar am meisten interessierten: Wie geht denn so ein Astronaut aufs Klo? Was ist denn, wenn er oder sie im All pupsen müssen? Und wie verständigt man sich denn mit Außerirdischen?
Danach konnte ich mit dem eigentlichen Vorlesen beginnen. Ich las aus »Fonk«, einem Kinderbuch von Tobias Goldfarb, in dem es um einen Jungen und einen kleinen Außerirdischen geht, die sich langsam anfreunden. Mein Publikum fand das alles klasse, lachte an den richtigen Stellen und war insgesamt sehr begeistert.
Eine schöne Lesung, ja! Und beim nächsten Mal habe ich dann hoffentlich etwas aus dem Umfeld meiner Arbeit daran, das ich den Kindern »verkaufen« kann …
Die Zigziger
Neuerdings sehe ich solche Formulierungen wieder auf Plakaten. Eines davon zeige ich hier. Und seither frage ich mich: Warum machen die Leute das? Nehmen die das ernst, oder ist es eine satirische Annäherung an die 90er-Jahre?
Es sind die »zigziger«-Jahre, wie es aussieht, die hier ihre Wiederauferstehung feiern. Aber vielleicht muss das so sein, und es handelt sich um eine Spracherweiterung, die auch bald durch eine Duden-Erwähnung geadelt wird ...
17 November 2022
Breitwand-Rockmusik
Die Platte hieß »Nightout« und wurde 1979 erstmals veröffetlicht. Ich ließ sie mir auf Kassette überspielen, und erst später kaufte ich sie mir, irgendwann in den frühen 80er-Jahren. Das ist lange her, und ich hatte die Platte schon lange nicht mehr gehört. Dieser Tage fischte ich sie aus dem Plattenschrank, legte sie auf und war durchaus davon angetan.
Klar, das ist alles meilenweit von Punkrock und artverwandten Klängen ab, sondern die Art von Rockmusik, die Ende der 70er-Jahre populär war: sehr wuchtig produziert, Stücke voller Pathos, mit vielen Instrumenten und einer stark im Vordergrund stehenden Frauenstimme, im Prinzip also Breitwand-Rockmusik. Das kann ich mir tatsächlich anhören, wobei mir nicht alle Stücke gefallen.
Die Stücke sind meist im mittleren Tempo, wirken manchmal richtig schunkelig und sind selten krachig. Wenige Stücke wie »Hideaway« sind knallig und schnell, das Titelstück der Platte eher ruhig, fast eine Ballade. Die Gitarren singen, bei den Stücken sind immer tolle Hintergrund-Chöre dabei, alles in allem ist das fett produziert.
Insgesamt ist die Platte ein Zeitdokument, das schwerst in den späten 70er-Jahren verankert ist und auch damals – in den Zeiten von Punk, New Wave, Ska, Reggae und frühem HipHop – nicht gerade modern war. Damit ist dieses Erstlingswerk von Ellen Foley eine Platte, die man nicht haben muss, die mir aber über weite Strecken immer noch gefällt. Daran kann aber schlicht die Tatsache schuld sein, dass ich sie in einem Alter hörte, in dem man von einer blonden Sängerin und ihrer Stimme schnell fasziniert ist …
Bis zum nächsten Anhören!
16 November 2022
Graphic Novel über einen Schreiber und Neinsager
Der amerikanische Schriftsteller Herman Melville ist im deutschsprachigen Raum vor allem durch seinen Roman »Moby Dick« bekannt geworden. Seine Erzählungen lohnen sich ebenfalls, eine der berühmtesten davon ist »Bartleby, der Schreiber«. Davon gibt es mittlerweile eine gelungene Version als Graphic Novel, die ich jederzeit empfehlen kann.
Die Geschichte klingt vergleichsweise einfach; sie spielt an der Wall Street in New York, die schon im 19. Jahrhundert ein Zentrum der Wirtschaft war. Dort steigt ein junger Mann namens Bartleby ins Berufsleben ein. Zuerst ist er sehr ordentlich, er verrichtet seine Arbeit zur Zufriedenheit von Kollegen und Vorgesetzten, und niemand hat einen Grund zur Klage.
Doch eines Morgens entscheidet er sich, nicht weiter zu arbeiten. Seine Argumentation ist schlicht und klar: »Ich möchte lieber nicht.« Und das zieht er konsequent durch: Bartleby kommt jeden Tag zur Arbeit, wo er brav bleibt, aber nichts arbeitet. Nach einiger Zeit verschärft sich die Situation, mit der seine Kollegen und auch die Arbeitgeber nicht klarkommen: Er bleibt im Büro, es wird sein Lebensmittelpunkt. Aber natürlich arbeitet er trotzdem nicht, denn: »Ich möchte lieber nicht …«
Dieser Satz wurde seitdem geradezu sprichwörtlich, und der junge Bartleby ist über die Jahrzehnte hinweg zu einer Figur geworden, die häufig zitiert wird. Herman Melville schrieb eine Geschichte, die einen sarkastischen Klang hat, viel vom damaligen Arbeitsleben erzählt und wegen ihres sturen »Helden« zu einem politischen Text wurde, der auch in die heutige Zeit wirkt: Was passiert eigentlich, wenn jemand beschließt, einfach kein Rädchen mehr in der Maschinerie sein zu wollen?
Der Comic-Künstler José Luis Munuera nahm sich des Stoffes an, bearbeitete die originale Geschichte und verwandelte sie in eine gelungene Graphic Novel. Der Künstler ist vor allem durch seine Arbeiten im humoristischen Fach bekannt geworden, unter anderem ist er für moderne Ausgaben von »Spirou und Fantasio« mitverantwortlich.
Seine literarische Bearbeitung lässt vom historischen Stoff genügend übrig, so dass man Melvilles Originalgeschichte gut nachvollziehen kann. Künstlerisch geht Munuera seinen eigenen Weg. Er zeichnet sowohl die Figuren als auch die Örtlichkeiten auf eigenständige Weise: irgendwo zwischen realistisch und leichtem Funny-Stil. Die Geschichte ist ernsthaft, die Zeichnungen sind es ebenfalls; bei den Gesichtern blitzt Munueras Erfahrung mit amüsanten Comics durch.
Seine Version von »Bartleby, der Schreiber« ist eigenständig, zugleich aber eine gelungene Variation des literarischen Klassikers. Man bekommt nach der Lektüre des Buches große Lust, das Original zu lesen. Wer schöne Comics mag oder literarische Umsetzungen zu schätzen weiß, sollte diese Graphic Novel einmal anschauen – es gibt eine kostenlose Leseprobe im Internet.
Erschienen ist »Bartleby, der Schreiber« als schöner Hardcover-Band im Splitter-Verlag. Er umfasst 72 Seiten und kostet 18,00 Euro. (Diese Rezension wurde bereits auf der PERRY RHODAN-Seite im Internet veröffentlicht. Hier kommt sie vor allem zur Dokumentation.)
Kein Reiseführer, aber ein schöner Einstieg
Šteger war mir vorhin als Schriftsteller nicht bekannt; er hat unter anderem Lyrik veröffentlicht und verfügt über einen durchaus kritischen Blick auf seine Heimat. Das merkt man bei diesem rundum unterhaltsamen und trotzdem informativen Rundgang durch Slowenien. Immer wieder gibt es Passagen, bei denen man als Leser schmunzelt; der Autor ignoriert aber nicht die aktuellen Probleme des Landes oder die düsteren Seiten der Vergangenheit.
Das Buch ist in vier Bereiche gegliedert. In »Allgemeines und Besonderes« liefert der Autor einen Streifzug zu allerlei Besonderheiten des Landes, von der Geschichte über die Religion bis hin zu den persönlichen Ansichten. In weiteren Kapiteln geht es aber auch um die Sinne, die in Slowenien angesprochen werden, um die Landschaften, die es in dem vielfältigen Land gibt, und um die Orte. Gut ist, dass sich Šteger nicht nur auf die Gegenden konzentriert, die für Touristen interessant sind, sondern auch solche auflistet, die man nicht unbedingt prominent im Reiseführer findet.
Er liefert mit seiner Gebrauchsanweisung eine gelungene Einstimmung für Slowenien. Das kleinen Land hat viel zu bieten, wie ich während einer zweiwöchigen Kurzreise dorthin feststellen konnte. Und wenn man mit offenen Sinnen durch ein Land fährt, findet man noch mehr schöne Ecken; Štegers Buch kann hier eine willkommene Unterstützung sein.
15 November 2022
Tödliche und ein wenig lahme Klippen
Die Serie spielt auf den Färöer-Inseln, die eigentlich die Hauptfigur sind: Die Landschaft ist reizvoll, wenngleich sehr karg. Schroffe Klippen, sanfte Hügel mit saftigem Grün, kleine Ortschaften und nur wenige Menschen. Wenn in so einer Umgebung ein Mord passiert, ausgerechnet an einer Umweltaktivistin sorgt das für Aufregung.
Helden des Films sind ein Journalist, der erfährt, dass das Mordopfer seine Tochter ist, von der er noch nie zuvor gehört hat (um es sehr grob zusammenzufassen), eine Polizistin, die den Auftrag hat, das Verbrechen aufzuklären, und ein mächtiger Industrieller, der natürlich seine Probleme mit Aktivisten hat. Gut und Böse sind vordergründig gut verteilt, problematisch ist halt, dass man als Zuschauer zu den meist grauen Figuren kaum eine positive Beziehung aufbauen kann.
Erzählt wird eher ruhig, Action gibt es praktisch keine. Leute fahren mit dem Auto, es gibt durchaus kontroverse Gespräche, Verwicklungen werden deutlich, und am Ende ist auch klar, wer die junge Frau umgebracht hat. Aber dann endet die Staffel mit einem neuerlichen Cliffhanger, und es ist klar, dass man die Fortsetzung praktisch braucht.
Ich kann die Serie nur eingeschränkt empfehlen. Sie ist ernsthaft, die Figuren handeln nachvollziehbar, aber sie ist nicht sehr spannend, fast ein wenig lahm. Wenn man sich auf das sehr ruhige Erzähltempo einlässt, wird man mit starken Bildern und einer glaubhaften Handlung belohnt. Immerhin!
Knallige Comic-Umsetzung des James-Bond-Mythos
Mit »James Bond Stories« liegt eine neue Serie vor, deren zwei Bände eine erzählerische Einheit bilden. Band eins trägt den Titel »Oddjob«, Band zwei wurde als »Goldfinger« publiziert. In beiden Bänden werden also Elemente aus dem klassischen Film »Goldfinger« aufgegriffen und in eine neue Zeit übertragen. Ich habe die beiden Bände mittlerweile gelesen und kann sie eingeschränkt empfehlen.
James Bond ist auf der halben Welt unterwegs. Anfangs hat er es dabei mit einem Gegner zu tun, der offensichtlich aus Korea stammt und ihm kämpferisch zumindest gleichwertig ist. Die beiden Männer stehen sich mehrfach gegenüber, sie helfen sich gegenseitig, und sie versuchen sich zu töten. Gleichzeitig stehen sie beide gegen eine Organisation, die weltweit operiert und Terroranschläge verübt. Wie sich nach einiger Zeit herausstellt, steckt ein skrupelloser Mann hinter allem, der als »Goldfinger« bezeichnet wird ...
Die Umsetzung in moderne Comics wurde von Greg Pak geschrieben. Der Autor greift Elemente aus alten »James Bond«-Romanen und -Filmen auf und verbindet sie neu. Dabei entsteht eine temporeiche Geschichte, die in jedem der einzelnen Hefte ihren Höhepunkt hat: Die Schauplätze wechseln, die Action steht oft im Zentrum. Die Männer schlagen sich, sie schießen aufeinander, sie kämpfen mit Terroristen und Geheimagenten.
Das ist, wenn man sich die Dimension eines Heftes anguckt, immer spannend gemacht und rasant erzählt. Auf die Länge eines Buches, das mehrere Hefte zusammenfasst, wirkt das Ganze häufig eher atemlos und hektisch; viele kleine Spannungsbögen folgen aufeinander, was dazu führt, dass der große Bogen der Handlung zwischen den vielen Effekten manchmal verschwindet.
Die künstlerische Umsetzung ist gelungen. Unterschiedliche Künstler erzählen die Geschichten, die vor allem in den Actcion-Szenen zu überzeugen wissen. Dabei bewegen sich die zwei Hardcover-Bände stets im Standard moderner amerikanischer Comics. Das ist gut gemacht, unterm Strich vielleicht ein wenig gesichtslos.
Alles in allem ist der Zweiteiler aus »Oddjob« und »Goldfinger« unterhaltsam und spannend, da kann man nicht meckern. Ganz überzeugen konnte mich das nicht, weil die Story schlicht zu hektisch ist.
Wer knallige Action mag, ist hier richtig. Wer »James Bond« mag, sollte ebenfalls zugreifen. Anspruchsvoll ist allerdings anders.
14 November 2022
Auf literarischer Tour
Am Donnerstagabend – also am 17. November – fahre ich nach Mainz. Dort treffe ich mich mit Lucy Guth, einer Autorin von Science Fiction, Fantasy und historischem Roman, mit der ich seit einigen Jahren zusammenarbeite. Sie wird aus ihrem aktuellen Roman lesen, ich erzähle ein wenig über die Serie, für die wir beide tätig sind.
Der Freitagmorgen, 18. November, wird anspruchsvoll: Ich bin Lesepate – oder wie das genau heißt – in einer Grundschule in Ettlingen, einer kleinen Stadt bei Karlsruhe. Dort lese ich an diesem Vormittag vor einer Bande von Zweitklässlern vor: nichts, an dem ich selbst beteiligt war, sondern ein fremder Text, den ich mir noch aussuchen muss.
Und am Freitagabend fahre ich dann nach Reutlingen. Abends bin ich an einer Veranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz beteiligt, das die Stadtbibliothek Reutlingen veranstaltet; die Hochschule ist ebenfalls beteiligt. Ich trete als Redakteur und Herausgeber auf, mit mir auf der kleinen Bühne sitzt der Autor Carsten Schmitt. Es geht letztlich um die Anthologie »Wie künstlich ist Intelligenz?«, die ich als Herausgeber betreut habe und in der Carsten Schmitt mit einer wunderbaren und vor allem preisgekrönten Geschichte vertreten war.
Ich finde das alles spannend und freue mich sehr! Berichte folgen ...
Nicht lächeln, bitte
»Ich lächle nie«, sagte die Frau auf einmal und verzog bei diesem Satz keine Miene. »Wer als Frau zu viel lächelt, wird als dümmlich oder naiv wahrgenommen, und das möchte nicht.«
Ich starrte sie an, war aber schlau genug, nichts zu sagen. Wir waren eine fröhliche Runde an diesem Spätsommertag; der Abend war schon ein wenig vorangeschritten, die Sonne neigte sich stärker, aber es war immer noch angenehm warm. Weingläser und Bierflaschen standen auf dem großen Tisch, wir waren alle in bester Laune.
»Aber warum das denn?«, fragte eine andere Frau. Ich kannte sie gut. Sie war das, was man »blitzg'scheit« nannte, hatte ein fröhliches Wesen und lachte gern und laut. »Da gibt's doch keinen Widerspruch.«
»Doch, den gibt es«, beharrte die Frau mit dem ernsthaften Gesichtsausdruck. »Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, die von den Regeln der Männer definiert wird. Und wenn eine Frau zu oft lacht oder lächelt, interpretieren das die Männer immer falsch. Das wiederum möchte ich nicht.«
Es entwickelte sich eine kurze Diskussion, die schnell ins Persönliche abglitt und damit endete, dass die ernsthafte Frau aufstand. »Ihr versteht mich nicht, und ihr wollt mich nicht verstehen«, sagte sie ruhig und ohne jegliche Regung im Gesicht. »Das ist dann Zeitverschwendung für mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend mit euren Männern und euren Gefühlen.«
Sie ging, und alle starrten ihr nach. Gut zwei Minuten lang herrschte Stille am Tisch, dann begann die Diskussion darüber. Und ich war stolz auf mich, weil ich es schaffte, weiterhin die Ruhe zu behalten und nichts zu sagen.
13 November 2022
Fachliteratur kann plagen
Das Problem: Ständig werde ich auf neue Bücher hingewiesen. Nicht nur in Anzeigen informieren die Verlage, sondern ebenso berichtet die jeweilige Redaktion darüber. Und da ich ein schwacher Mensch bin, schreibe ich mir ständig neue interessante Bücher heraus, die ich mir dann teilweise kaufe – manchmal immerhin kann ich widerstehen.
Eine Lösung für mein selbst verursachtes Problem habe ich nicht. Mir ist klar, dass ich nicht so viel lesen kann, wie ich gerne würde. Das Leben ist endlich, die tägliche Zeit sowieso. Immerhin schaffe ich es schon, an Buchhandlungen vorbeizugehen, ohne sie zu betreten oder gar etwas zu kaufen.
Ein wahres Luxusproblem, schon klar. Aber an einem gemütlichen Sonntag, der sich zwischen Manuskripten und Fachzeitschriften, fällt es mir besonders auf ...
11 November 2022
Er war auch mein Sprachpapst
Ich kaufte mir »Deutsch fürs Leben« und später »Deutsch für Profis« von Wolf Schneider, und ich las auch eines seiner Handbücher für Journalisten, das mir einer der erfahrenen Zeitungsredakteure auslieh. Und es eröffnete sich eine neue Welt für mich: Viele Dinge, die ich vorher intuitiv richtig oder falsch gemacht hatte, bekam ich nun klarer vermittelt.
Schneider schärfte meinen Sinn für unnötige Wörter und gespreizte Formulierungen; von ihm übernahm ich die Abneigung gegen Bürokratendeutsch und Wörter wie »durchführen« und »Maßnahmen«, die Politiker gern benutzen, um die Wahrheiten zu verschleiern, die aber Autoren und Übersetzer meiden sollten. Ich lernte viel aus seinen Büchern, las immer wieder darin und empfahl sie gern weiter.
Zuletzt fiel er durch sehr konservative Positionen zur deutschen Sprache auf. Ich nahm sie ihm nicht übel: Wer über neunzig Jahre alt ist, von dem erwarte ich nicht, dass er jede sprachliche Neuerung mit Begeisterung aufgreift.
In der Nacht auf den heutigen Freitag ist er gestorben, wie aus Medienberichten bekannt wurde. Wolf Schneider wurde 97 Jahre alt. Ich werde seine Sachbücher in Ehren halten – auch wenn sie in manchen Punkten nicht mehr »up to date« sind.
Dorian und der Duk Duk
»Dorian Hunter« ist aber immer ein großes Stück anspruchsvoller, und das beginnt häufig bei der Erzählweise. Während bei »John Sinclair« mit einer Erzählerin gearbeitet wird und man den Geschichten oft anmerkt, wie trashig sie schon im Original waren, geht es bei der »Dorian Hunter«-Folge 47 mit den Erzählebenen ein wenig komplexer zu.
Die eigentliche Geschichte ist dieses Mal die einer Begegnung, die man nur versteht, wenn man die Serie kennt, und die einer Erzählung. Die Erzählung wiederum ist die, für die der Titel »Duk Duk« für die Folge gewählt wurde.
Verwirrt? Macht nichts.
Die Folge 47 dieser Serie ist vor allem für die Stammleser und -hörer gedacht. Sie wissen die Figuren einzuordnen, sie wissen, wer Olivaro und Coco sind und was das alles mit Dorian Hunter zu tun hat. Den verschlägt es diesmal auf eine Insel im südlichen Pazifik, wo er auf Stammeskrieger und allgegenwärtige Dämonen oder Geister stößt.
Es wird geflucht und geschossen, es wird getanzt und gerannt – ständig passiert etwas, ständig ist die Handlung in Bewegung. Das ist stets spannend gemacht, Langeweile kommt dabei keine auf. Man muss sich halt mit dem Thema auskennen, um die Details zu verstehen.
Ich halte »Dorian Hunter« für eine sehr gute Horror-Serie; die düsteren Ideen und Romane von Ernst Vlcek werden im Hörspiel hervorragend in die heutige Zeit übertragen. Und jemand, der sich mit dieser Serie auskennt, wird die Folge »Duk Duk« zu schätzen wissen.
10 November 2022
Ein Meisterwerk von 1981
Dabei fällt es mir heute schwerer als damals, anderen Leuten zu vermitteln warum ich die Platte so gut finde. Sie ist weit entfernt von der Musik, die ich sonst höre, sie ist rhythmischer und weniger melodisch. Aber sie hat eindeutig ihre Reize – und ich glaube, es liegt daran, dass sie überrascht.
Die beiden Musiker waren zu jener Zeit schon bekannte Pop-Stars, der eine durch die Talking Heads, der andere durch Roxy Music. Bei manchen Stücken dieser Platte kann man die Talking Heads auch heraushören. Alle Stücke bestehen aus einer durchaus komplexen Musik, die weit entfernt von »normalem« Pop ist, die häufig afrikanisch oder asiatisch klingt, und allerlei Samplings.
Geräusche werden in die Stücke gemischt, Gespräche und arabisch klingender Gesang. Ein Prediger schimpft und hetzt, Computer zirpen, Schlagzeuger trommeln hektische Rhythmen, über allem schwebt etwas, das man heute als »multikulturell« bezeichnen könnte. Und ich bin sicher, dass die Platte heute durchaus wegen »kultureller Aneignung« kritisch betrachtet würde.
Als ich sie anfangs der 80er-Jahre erstmals hörte, weitete sie meinen Blick auf die Musik. Vorher kannte ich beispielsweise keine arabischen Klänge, so etwas lief nun mal nicht im Radio. Ob man das Album nun als Weltmusik bezeichnen kann oder nicht, kann ich nicht sagen – es ist mir tatsächlich egal.
»My Life in the Bush of Ghosts« hat mich damals begeistert und fasziniert. Und wenn ich mir die Platte heute anhöre, ist sie immer noch interessant und verblüffend. Ich bin sicher, sie in den kommenden Jahren noch oft zu hören. So eine Vinylscheibe hält nun mal doch lang …
09 November 2022
Ein literarisch-historischer Roman
Auf den ersten Blick kommt er als historischer Roman her. Die Handlung spielt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der englische Uhrmachermeister Alister Cox erhält eine Einladung aus China. Mit drei Gehilfen reist er an den Hof des Kaisers von China, in dessen Auftrag er eine Uhr bauen soll, die für alle Ewigkeit das Mysterium der Zeit bannen soll. Doch die Reise ist nicht nur eine Fahrt in eine völlig fremdartige Kultur, sondern auch eine Fahrt ins Innere eines Mannes, der von der Trauer um den Tod seiner Tochter erfüllt ist.
Die Engländer tun sich schwer mit der chinesischen Kultur. Der Kaiser gilt als Herr der Zeit, als unfehlbar. Es gibt zahlreiche Verbote, die sich den Engländern – sie lernen die ganze Zeit über kein Wort der fremden Sprache – verschließen; sie bekommen aber mit, zu welch drakonischen Strafen gegriffen wird. Im Reich der Mitte wird schnell hingerichtet, und eine solche Hinrichtung besteht aus fürchterlicher Folter.
Das alles zeigt der Autor in einem Stil, den ich für ungewöhnlich halte. Er verzichtet praktisch komplett auf Dialoge, im ganzen Buch gibt es keine An- und Abführungszeichen. Es gibt wenig indirekte Rede, die Sprache ist oft gewollt distanziert. Und trotzdem ist das alles spannend erzählt und saugt einen nach kurzer Verwirrung am Anfang immer stärker in die Geschichte hinein.
Das gelingt vor allem, weil der Autor seine Sicht auf Cox sehr klar gestaltet. Der Uhrmacher ist ein gebrochener Mann, der von seiner toten Tochter träumt. Wenn er versucht, eine wundersame Uhr zu bauen, will er damit auch dem Tod entgegentreten. Und der Kaiser? Er ist gleichzeitig von der Zeit besessen, über alle kulturellen und sonstigen Grenzen hinweg.
»Cox oder Der Lauf der Zeit« ist kein umfangreicher Roman. Weil er aber sehr dicht geschrieben ist, auch mit durchaus komplexen Sätzen, braucht man einige Zeit für ihn. Es ist eine intensive Lektüre, die mich nicht kaltgelassen hat und deren Bilder noch länger in mir nachwirken. Ein großartiges Buch, das ganz nebenbei philosophische Gedanken vermittelt – bei aller Spannung, die durch die kulturellen Unterschiede entsteht.
07 November 2022
Kontrafaktisches im Seminar
Es geht um die phantastische Kurzgeschichte, und das eigentliche Thema ist ein »Was wäre wenn« – also wie hätte sich die Geschichte verändern können, wenn sich an einem bestimmten Punkt etwas anders ereignet hätte? Bekannte Romane dieses Unter-Genres sind »Das Orakel vom Berge« von Philip K. Dick oder »Vaterland« von Robert Harris.
Bei unserem Seminar geht es um die Kurzgeschichte. Wie schaffe ich es, einen komplexen Weltenbau einer phantastischen Welt so zu verknappen, dass ich eine Kurzgeschichte zu diesem Thema schreiben kann? Diesem Thema nähern wir uns mit Aufgaben und Diskussionen an; wir schreiben Texte, und wir sprechen darüber. Das ist durchaus mal kotrovers – es gibt bei Literatur schließlich immer wieder unterschiedliche Herangehensweisen.
Das Seminar begann am Sonntag, es geht bis Dienstag. Wenn ich diese Zeilen schreibe, ist es zu einem großen Teil vorüber. Einen ausführlicheren Bericht reiche ich sicher nach.
04 November 2022
Die »Was wäre wenn«-Frage
Heute beschäftige ich mich wieder – neben der normalen Arbeit – mit den Texten, die von den Autorinnen und Autoren für dieses Seminar eingereicht worden sind. Einige Personen kenne ich bereits von früheren Seminaren her, von anderen habe ich schon Texte gelesen.
Es soll um »kontrafaktische Historie« gehen, unter anderem, also um Geschichte, die davon ausgehen, dass sich die Wirklichkeit anders entwickelt hat, als wir uns das vorstellen. Ich freue mich schon jetzt auf den Austausch mit den Leuten, die ich in Wolfenbüttel antreffen werde!
Flugvampire greifen an
Tatsächlich ist die Handlung dieser Geschichte komplett hanebüchen. Während John Sinclair in London weilt, werden zwei Freunde von ihm in Nepal in einen Kampf mit Flugvampiren hineingezogen. Sie werden in einem Gebäude belagert, schicken telepathische Hilferufe nach London, und Sinclair macht sich auf den Weg.
Das Flugzeug, mit dem er nach Nepal reist, wird unterwegs von fliegenden Vampiren angegriffen und mithilfe schwarzer Magie zur Landung im Gebirge gezwungen. Dort kommt es zu einem Kampf, in dem die Flugvampire zu Dutzenden umgebracht werden …
Man fragt sich bei solchen Geschichten ja unweigerlich, wieso es überhaupt noch die Mächte der Hölle gibt, wenn sie ständig und in jeder Folge zu Dutzenden umgebracht werden. Vor allem scheint es mit ihrer Macht nicht weit her zu sein, wenn Sinclair nur sein magisches Kreuz heben und alle Probleme mit ein bisschen Gefuchtel lösen kann.
Aber nach solchen Gesichtspunkten frage ich gar nicht, wenn ich so ein Hörspiel höre. Das Team um Dennis Ehrhardt schafft es wieder einmal, aus einem Heftroman, der im Jahr 1977 erstmals in der Reihe der »Gespenster-Krimis« erschienen ist, ein packendes Audio-Abenteuer zu machen.
Die Dialoge sind knapp und treiben die Handlung voran; sie haben sogar so etwas wie eine innere Logik. Das Geschrei der Vampire, das Ballern der Schusswaffen, das entsetzte Wimmern von verängstigten Frauen – das Frauenbild dieser Romane sollte sich mal eine Person anschauen, die sich damit besser auskennt ... –, das alles ist stark in Szene gesetzt.
Ich erwarte bei einem »John Sinclair«-Stoff nicht gerade viel Logik. Ich erwarte, dass die manchmal haarsträubenden Geschichten so umgesetzt werden, dass ich ihnen gern folge. Das schaffen die Macher der »John Sinclair«-Hörspiele fast immer.
»Flugvampire greifen an« bildet wieder einmal keine Ausnahme!
03 November 2022
In der Ausgabe 14 des Agent Provocateur
Bei meinem Text handelte es sich um eine Geschichte mit religiösem Anklang, die aber vor allem in einer negativ erscheinenden Zukunft spielte. Auf zwei Seiten wurde sie veröffentlicht, und ich würde heute so gut wie alles an ihr völlig anders schreiben – aber man verändert sich eben als Mensch und als Gelegenheitsautor im Verlauf der Jahrzehnte.
Die Geschichte passte gut in ein Heft, in dem neben mir und den beiden Herausgebern auch Michael Kemper – heute als Michael Haitel und als Verleger in der Science-Fiction-Szene aktiv – und Johannes Unnewehr, der heute gelegentlich Science Fiction im Eigenverlag publiziert, sowie weitere Autoren mitwirkten. Mit Irene Salzmann und Ute Mackenberg waren zwei immerhin Autorinnen vertreten; bei den Bildern hatte man mit den Atzenhofer-Brüdern, Frans Stummer und Torsten Wolber bekannte Leute verpflichtet.
Herausgeber des Fanzines, das eine Auflage von 100 Exemplaren erreichte, waren der leider schon verstorbene Achim Mehnert aus Köln und Joachim Stahl, der damals in Heidelberg wohnte und den ich zuletzt als Übersetzer von »Micky Maus«-Comics wahrnahm. Ich mochte beide Fan-Autoren sehr, und ich mochte dieses Fanzine.
Und wann immer ich so ein Heft durchblättere, finde ich es sehr traurig, dass diese Art von Fanzines ausgestorben ist. Sie präsentierten für kleines Geld oft eine spannende Mischung aus Text und Bild – ohne dass man sich als Gelegenheitsautor einbildete, man sei in einer Anthologie gelandet und auf dem Weg zu unsterblichem Ruhm …