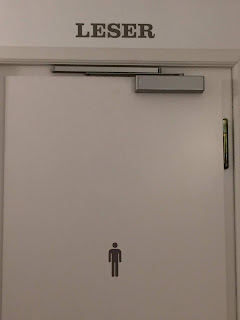Ich weiß, dass viele »ernsthafte« Fantasy-Fans aus meiner Generation ihre Probleme mit den »Harry Potter«-Romanen hatten. ich erinnere mich an die Verrisse »von oben herab« zu den Büchern. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an meine Freude, als ich die ersten Bücher der Serie las und mich eben wie ein Junge fühlte, der in die Welt der Magie einsteigt.
So ging es mir nicht, als ich die Filme im Kino ansah – als kleiner Junge funktionierte es für mich nicht. Aber das änderte nichts an meiner jeweiligen Freude ...
Ich sah alle »Harry Potter«-Filme zu ihrer jeweiligen Zeit im Kino, einen Teil sogar in Hollywood, in einem plüschigen Kinosaal am Hollywood Boulevard. Ich fand sie teilweise gut, teilweise albern, teilweise brillant. Und über die Feiertage schaute ich sie mir alle noch einmal an: bequem auf dem Sofa daheim, eine DVD aus der Box nach der anderen.
Wichtige Erkenntnis: Diese Filme sind gut gealtert. Ich musste mich kein einziges Mal dafür schämen, dass ich sie mal gut gefunden hatte. Sie sind sehr gut gemacht, sie sind unterhaltsam, sie sind schnell erzählt und machen mir immer noch Freude.
Vor allem ist die Veränderung der Figuren immer noch klar und spannend. Was im ersten Film noch echte Teenager sind, werden irgendwann junge Erwachsene, die alle Variationen von Teenage-Liebe durchmachen. Und was als eher witzige Zauberer-Serie anfängt, wird am Ende zu einer Parabel auf Faschismus und die Kraft des Widerstandes.
Die abschließenden zwei Teile der Folge sieben sind tatsächlich ein Beispiel dafür, wie unterhaltsam und wie spannend man Politik erzählen kann. Die Herrschaft des Dunklen Lords, der Widerstand einiger tapferer Leute, das Anpassen von vielen anderen – das alles wird eindrucksvoll in Szene gesetzt.
Doch: Ich mochte die »Harry Potter«-Filme, und das zum wiederholten Mal. Ich bin mir zudem sicher, dass ich sie bald wieder anschauen werde. Vielleicht zu Weihnachten 2019 …
Es passiert einiges um mich herum, und nicht alles gefällt mir. Vieles fasziniert mich, vieles interessiert mich – und das soll Thema dieses Blogs sein.
28 Dezember 2018
27 Dezember 2018
Chango mit einem ruppigen Stück
Man braucht sogar als Süddeutscher einige Zeit, um den Text von »I Heas Maschian« zu verstehen. Das Stück stammt von der österreichischen Band Chango und ist im lokalen Dialekt gehalten. Und es geht um die marschierenden Nazis, die eben auch in Österreich immer mehr von sich reden machen.

Welche Schublade für die Musik passend ist, weiß ich nicht. Das Band-Info spricht von Stoner-Rock – dann wird das so sein. Ein dumpf wummernder Bass trägt das Stück, die gesamte Instrumentierung ist schleppend und zäh, packt mich aber beim zweiten und dritten Mal immer mehr: klassische Rockmusik, halt schleppend gespielt, durchaus gewöhnungsbedürftig und von Mal zu Mal besser klingend.
Was Chango machen, ist definitiv kein Punkrock oder sonst was, das ich mir täglich anhöre. Aber es ist ein starkes Stück, das auf die weitere Musik der Band sehr neugierig macht.

Welche Schublade für die Musik passend ist, weiß ich nicht. Das Band-Info spricht von Stoner-Rock – dann wird das so sein. Ein dumpf wummernder Bass trägt das Stück, die gesamte Instrumentierung ist schleppend und zäh, packt mich aber beim zweiten und dritten Mal immer mehr: klassische Rockmusik, halt schleppend gespielt, durchaus gewöhnungsbedürftig und von Mal zu Mal besser klingend.
Was Chango machen, ist definitiv kein Punkrock oder sonst was, das ich mir täglich anhöre. Aber es ist ein starkes Stück, das auf die weitere Musik der Band sehr neugierig macht.
Superspannender Berlin-Thriller
Ich kenne den Schriftsteller Martin Krist persönlich, wir haben uns zuletzt beim LiteraturCamp in Heidelberg sehr gut unterhalten. Das färbt meinen Eindruck von seinen Büchern natürlich positiv sein – und das sollte ich einer Rezension auch vorausschicken. Nur: Das ändert nichts daran, dass ich seinen Krimi »Böses Kind« hervorragend fand.
 In kurzen Kapiteln, die in filmischer Weise sehr schnell hintereinander geschnitten worden sind, erzählt der Autor seine Geschichte. Dabei wählte er verschiedene Blickwinkel. Seine Hauptfigur ist Henry Frei, ein Kommissar, der einen Haufen eigener Geheimnisse mit sich herumschleppt. Mit seinen Kollegen führt er einen aussichtslos erscheinenden Kampf gegen Verbrecher aller Art.
In kurzen Kapiteln, die in filmischer Weise sehr schnell hintereinander geschnitten worden sind, erzählt der Autor seine Geschichte. Dabei wählte er verschiedene Blickwinkel. Seine Hauptfigur ist Henry Frei, ein Kommissar, der einen Haufen eigener Geheimnisse mit sich herumschleppt. Mit seinen Kollegen führt er einen aussichtslos erscheinenden Kampf gegen Verbrecher aller Art.
Die andere Hauptfigur ist eine junge Frau namens Suse. Nachdem sie von ihrem Mann verlassen worden ist, wohnt sie mit drei Kindern in einer winzigen Wohnung. Sie erhält von ihrem Mann kein Geld, ist also gezwungen, jeden Tag arbeiten zu gehen, und geht zwischen ihren Pflichten und dem täglichen Stress fast unter.
Eines Morgens stellt Suse fest, dass ihre Tochter Jacqueline nicht mehr da ist. Statt dessen steht ein Mann im Garten und starrt Suse an. Suse dreht fast durch vor Sorge, sucht ihre Tochter trotz des Stresses, das sie in ihrem Umfeld hat, findet sie nicht, meldet sich bei der Polizei und wird von dieser nicht sonderlich ernst genommen.
Zur gleichen Zeit finden Henry Frei und seine Leute einen verstümmelten Hund, dann eine männliche Leiche. Es scheint einen direkten Zusammenhang zu Suse und ihrer Tochter zu geben. Und offenbar drängt die Zeit – damit es nicht bald weitere Tote gibt …
Der Thriller läuft in rasendem Tempo ab. Ständig passiert etwas, schnelle Dialoge wechseln sich ab mit rascher Action. Hinter jeder Figur scheint ein Geheimnis zu stecken, auch die Polizisten sind keine Charaktere, die einem als hundertprozentig korrekt vorkommen. Damit schafft es der Autor, einen Leser immer wieder zu überraschen.
Interessant fand ich eines: Obwohl Martin Krist eine Art hat, seine Dialoge zu führen, die meinem Geschmack gar nicht entspricht, störte mich das irgendwann nicht mehr – so sehr vermochte er mich zu packen und in seinen Thriller hineinzuziehen. Nachdem ich mich auf »Böses Kind« eingelassen hatte, war ich kaum mehr in der Lage, mit der Lektüre aufzuhören.
Den Roman hat der Autor als Selfpublisher veröffentlicht. Ich kaufte die Taschenbuchausgabe via Amazon – auf seiner Internet-Seite informiert Martin Krist über seine Vertriebssituation. (Und weil mich »Böses Kind« so gepackt hat, bestellte ich mir auch gleich die Fortsetzung. So funktioniert das eben …)
 In kurzen Kapiteln, die in filmischer Weise sehr schnell hintereinander geschnitten worden sind, erzählt der Autor seine Geschichte. Dabei wählte er verschiedene Blickwinkel. Seine Hauptfigur ist Henry Frei, ein Kommissar, der einen Haufen eigener Geheimnisse mit sich herumschleppt. Mit seinen Kollegen führt er einen aussichtslos erscheinenden Kampf gegen Verbrecher aller Art.
In kurzen Kapiteln, die in filmischer Weise sehr schnell hintereinander geschnitten worden sind, erzählt der Autor seine Geschichte. Dabei wählte er verschiedene Blickwinkel. Seine Hauptfigur ist Henry Frei, ein Kommissar, der einen Haufen eigener Geheimnisse mit sich herumschleppt. Mit seinen Kollegen führt er einen aussichtslos erscheinenden Kampf gegen Verbrecher aller Art.Die andere Hauptfigur ist eine junge Frau namens Suse. Nachdem sie von ihrem Mann verlassen worden ist, wohnt sie mit drei Kindern in einer winzigen Wohnung. Sie erhält von ihrem Mann kein Geld, ist also gezwungen, jeden Tag arbeiten zu gehen, und geht zwischen ihren Pflichten und dem täglichen Stress fast unter.
Eines Morgens stellt Suse fest, dass ihre Tochter Jacqueline nicht mehr da ist. Statt dessen steht ein Mann im Garten und starrt Suse an. Suse dreht fast durch vor Sorge, sucht ihre Tochter trotz des Stresses, das sie in ihrem Umfeld hat, findet sie nicht, meldet sich bei der Polizei und wird von dieser nicht sonderlich ernst genommen.
Zur gleichen Zeit finden Henry Frei und seine Leute einen verstümmelten Hund, dann eine männliche Leiche. Es scheint einen direkten Zusammenhang zu Suse und ihrer Tochter zu geben. Und offenbar drängt die Zeit – damit es nicht bald weitere Tote gibt …
Der Thriller läuft in rasendem Tempo ab. Ständig passiert etwas, schnelle Dialoge wechseln sich ab mit rascher Action. Hinter jeder Figur scheint ein Geheimnis zu stecken, auch die Polizisten sind keine Charaktere, die einem als hundertprozentig korrekt vorkommen. Damit schafft es der Autor, einen Leser immer wieder zu überraschen.
Interessant fand ich eines: Obwohl Martin Krist eine Art hat, seine Dialoge zu führen, die meinem Geschmack gar nicht entspricht, störte mich das irgendwann nicht mehr – so sehr vermochte er mich zu packen und in seinen Thriller hineinzuziehen. Nachdem ich mich auf »Böses Kind« eingelassen hatte, war ich kaum mehr in der Lage, mit der Lektüre aufzuhören.
Den Roman hat der Autor als Selfpublisher veröffentlicht. Ich kaufte die Taschenbuchausgabe via Amazon – auf seiner Internet-Seite informiert Martin Krist über seine Vertriebssituation. (Und weil mich »Böses Kind« so gepackt hat, bestellte ich mir auch gleich die Fortsetzung. So funktioniert das eben …)
23 Dezember 2018
Bietigheim oder Öhringen
Ich sah auf die Notizen, wieder und wieder, und so langsam wurde ich verzweifelt. Wie es aussah, hatte ich eine Lesung in Bietigheim-Bissingen, im Jugendzentrum, und diese war für den 30. Dezember anberaumt. Kein richtig guter Termin, aber zu schaffen. Ich sollte dort aus meinen Punkrock-Büchern vorlesen.
Dummerweise hatte ich für denselben Tag auch eine Lesung in Öhringen, am selben 30. Dezember. Ich sollte dort – zusammen mit anderen Autoren – Fantasy-Texte vortragen. Aber wie war das geschehen, wie konnte ich diesen Terminwirrwarr hinzaubern? Und vor allem: Wie kam ich da wieder heraus?
Öhringen und Bietigheim lagen nicht so weit auseinander, das konnte ich mit flotter Fahrt recht schnell schaffen. Wenn ich versuchte, an einem Abend zwei Lesungen zu machen? Ich würde in Öhringen ein wenig Fantasy vortragen, dann auf die bekannteren Fantasy-Kollegen überleiten und verschwinden. Ich käme noch zeitig in Bietigheim im Jugendzentrm an, um dort zu vorgerückter Zeit meine Punkrock-Texte vorzutragen.
Ein Telefonat mit den Veranstaltern in Bietigheim belehrte mich darüber, dass das so nicht funktionieren konnte. Dort würde nach mir eine »JuZ-Disco« losgehen, und die jungen Leute dort freuten sich schon darauf, nach der Lesung tanzen zu können.
Ich war irgendwann völlig verzweifelt, der Schweiß trat mir auf der Stirn. Vielleicht sollte ich eine Krankheit simulieren und einfach beide Termine auf einmal absagen? Das wäre nicht elegant, aber immerhin möglich.
Da wachte ich endlich aus meinem Traum auf.
Dummerweise hatte ich für denselben Tag auch eine Lesung in Öhringen, am selben 30. Dezember. Ich sollte dort – zusammen mit anderen Autoren – Fantasy-Texte vortragen. Aber wie war das geschehen, wie konnte ich diesen Terminwirrwarr hinzaubern? Und vor allem: Wie kam ich da wieder heraus?
Öhringen und Bietigheim lagen nicht so weit auseinander, das konnte ich mit flotter Fahrt recht schnell schaffen. Wenn ich versuchte, an einem Abend zwei Lesungen zu machen? Ich würde in Öhringen ein wenig Fantasy vortragen, dann auf die bekannteren Fantasy-Kollegen überleiten und verschwinden. Ich käme noch zeitig in Bietigheim im Jugendzentrm an, um dort zu vorgerückter Zeit meine Punkrock-Texte vorzutragen.
Ein Telefonat mit den Veranstaltern in Bietigheim belehrte mich darüber, dass das so nicht funktionieren konnte. Dort würde nach mir eine »JuZ-Disco« losgehen, und die jungen Leute dort freuten sich schon darauf, nach der Lesung tanzen zu können.
Ich war irgendwann völlig verzweifelt, der Schweiß trat mir auf der Stirn. Vielleicht sollte ich eine Krankheit simulieren und einfach beide Termine auf einmal absagen? Das wäre nicht elegant, aber immerhin möglich.
Da wachte ich endlich aus meinem Traum auf.
22 Dezember 2018
Seerundfahrt mit Amerikanern
Das Schiff legte ab, die Fahrt begann. Wir hatten ganz spontan beschlossen, eine Rundfahrt über den See zu unternehmen. Unsere Meinung: »Wenn man schon mal in Zürich ist und das Wetter auch verspricht, sogar im Herbst schön zu bleiben, sollte man das nutzen.« Und so setzten wir uns aufs Deck, sahen in aller Ruhe zu, wie das Schiff die Anlegestelle verließ und auf den See hinausfuhr.
Es war ein herrlicher Tag. Die Sonne kam zwischen den Wolken hervor, als ob wir sie gebucht hätten. Ich blickte auf den Bürkliplatz zurück, der hinter uns schnell kleiner wurde, und widmete mich dann lieber dem Blick nach vorne.
Das Schiff war wie ein Bus – wir hatten ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel, das den ganzen Tag galt und bei dem wir nur einen Aufpreis fürs Schiff zahlen mussten – und hielt immer wieder an. Das fand ich aber gut, so hatte ich immer wieder die Gelegenheit, saubere und ordentliche Anlegestellen zu bewundern, zwischendurch sogar eine Schokoladenfabrik. Ich genoss die Fahrt über den See.
Bis die Stimmen in mein Ohr drangen. Vor allem eine Stimme war es. Ein Tisch von uns entfernt saß ein Paar, das sich auf Englisch unterhielt, dem Akzent nach waren es Amerikaner. Der Mann trank Rotwein, den er eifrig beim Personal bestellte, die Frau redete. Sie hatte eine sehr helle Stimme, die ich als durchdringend empfand.
Was sie sagte, war fast egal. Aufgrund ihres Akzentes verstand ich nur die Hälfte. Sie blickte kein einziges Mal auf den See oder auf die Dörfer, ebensowenig der Mann. Er trank, sie redete, und ihre Stimme ging mir in die Ohren, immer tiefer hinein in den Kopf, bis sie auf den Punkt stieß, an dem sie ich tierisch nervte.
Ich war geradezu stolz auf mich, dass ich ruhig blieb. Ich versuchte alles, um die Stimme zu ignorieren, blickte auf die Häuser am See, kommentierte einzelne Boote und erfreute mich an mutigen Schwimmern. Aber die Stimme drang trotzdem immer in mein Bewusstsein.
So erfuhr ich einiges über das Leben in einer großen Stadt, über Konflikte mit Nachbarn und der Familie, über die vergangenen Wochen und Monate. Die Stimme konnte ich irgendwann nicht mehr ausblenden, so schön ich auch den See und die Sonne empfand. Anfangs hatte ich mir gewünscht, die Fahrt möge eine Stunde mehr oder zwei Stunden mehr dauern; am Ende war ich froh, als sie vorüber war.
Als ich am Bürkliplatz das Schiff wieder verließ, war die Stimme immerhin verstummt. Das erleichterte mich.
Es war ein herrlicher Tag. Die Sonne kam zwischen den Wolken hervor, als ob wir sie gebucht hätten. Ich blickte auf den Bürkliplatz zurück, der hinter uns schnell kleiner wurde, und widmete mich dann lieber dem Blick nach vorne.
Das Schiff war wie ein Bus – wir hatten ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel, das den ganzen Tag galt und bei dem wir nur einen Aufpreis fürs Schiff zahlen mussten – und hielt immer wieder an. Das fand ich aber gut, so hatte ich immer wieder die Gelegenheit, saubere und ordentliche Anlegestellen zu bewundern, zwischendurch sogar eine Schokoladenfabrik. Ich genoss die Fahrt über den See.
Bis die Stimmen in mein Ohr drangen. Vor allem eine Stimme war es. Ein Tisch von uns entfernt saß ein Paar, das sich auf Englisch unterhielt, dem Akzent nach waren es Amerikaner. Der Mann trank Rotwein, den er eifrig beim Personal bestellte, die Frau redete. Sie hatte eine sehr helle Stimme, die ich als durchdringend empfand.
Was sie sagte, war fast egal. Aufgrund ihres Akzentes verstand ich nur die Hälfte. Sie blickte kein einziges Mal auf den See oder auf die Dörfer, ebensowenig der Mann. Er trank, sie redete, und ihre Stimme ging mir in die Ohren, immer tiefer hinein in den Kopf, bis sie auf den Punkt stieß, an dem sie ich tierisch nervte.
Ich war geradezu stolz auf mich, dass ich ruhig blieb. Ich versuchte alles, um die Stimme zu ignorieren, blickte auf die Häuser am See, kommentierte einzelne Boote und erfreute mich an mutigen Schwimmern. Aber die Stimme drang trotzdem immer in mein Bewusstsein.
So erfuhr ich einiges über das Leben in einer großen Stadt, über Konflikte mit Nachbarn und der Familie, über die vergangenen Wochen und Monate. Die Stimme konnte ich irgendwann nicht mehr ausblenden, so schön ich auch den See und die Sonne empfand. Anfangs hatte ich mir gewünscht, die Fahrt möge eine Stunde mehr oder zwei Stunden mehr dauern; am Ende war ich froh, als sie vorüber war.
Als ich am Bürkliplatz das Schiff wieder verließ, war die Stimme immerhin verstummt. Das erleichterte mich.
21 Dezember 2018
Kosmopoliten kontra Malocher
In den vergangenen Monaten las ich immer wieder einen Ansatz, der erklären sollte, woher ein Teil der aktuellen Konflikte komme. Die »Zeit« formulierte es in einem großen Artikel, irgendwelche Politiker schwatzen davon. Letztlich geht die Argumentation immer in eine Richtung, mal positiv, mal negativ konnotiert – ich fasse sie grob zusammen.
Auf der einen Seite der Gesellschaft stehen die urbanen Mittelschichten, also pfiffige Leute, die mehrere Sprachen können, meist gut Geld verdienen und weit gereist sind. Denen sind so Dinge wie die »deutsche Nation« egal, die haben auch kein Problem mit Menschen anderer Hautfarbe oder anderer sexueller Ausrichtung. Auf der anderen Seite der Gesellschaft stehen nach dieser Erzählung die »einfachen Leute«, die kaum aus ihrem Dorf herauskommen, die sich mit »einfacher Arbeit« herumschlagen müssen und die Angst um ihre Jobs haben, die keine Ausländer kennen und von Schwulen verschreckt werden könnten.
Man könnte es auch so sehen: Die coolen Kosmopoliten und die schlichten Malocher kommen nicht miteinander klar. Deshalb wählen die coolen Kosmopoliten eher die »liberalen« Parteien, während die Malocher neuerdings für die AfD und anderen Mist schwärmen.
Es ist eine einfache Erklärung, und wenn man sie schluckt, sieht man die Welt auf einmal viel klarer. Es ist eine Erklärung, die den Rechten dient: Sie können den »einfachen Leuten« erklären, sie würden für sie gegen die Kosmopoliten kämpfen. (Obwohl die AfD-Politikerin Alice Weidel sicher ein perfektes »Role Model« für eine Kosmopolitin abgeben könnte.) Und wer sich selbst zu den Kosmopoliten zählt, kann sich schön von den »Trotteln« abgrenzen und seine Ressentiments pflegen.
Es ist ja nicht so, dass ich eine komplette Theorie für die Probleme dieser Welt anzubieten hätte. Aber dass die Einteilung in Malocher und Kosmopoliten die Welt nicht schöner macht, liegt auf der Hand.
Als ob Menschen aus der Unter- oder Arbeiterklasse dazu verdonnert wären, ausländerfeindlich oder schwulenängstlich zu sein ... Als ob Menschen aus der Mittel- oder Oberschicht automatisch deshalb bessere Menschen wären, weil sie nichts dagegen haben, wenn ein türkischstämmiger Rechtsanwalt oder afrikanisch aussehender Ingenieur im benachbarten Reihenhaus wohnt …
Solidarität ist keine Frage des Geldbeutels, Menschenfeindlichkeit eine Frage von vielen Weltreisen. Der Prozentsatz an Idioten ist in den sozialen Schichten wahrscheinlich recht gleichmäßig verteilt. Und die Trennung in Kosmopoliten und Malocher, wie intellektuell diese auch herbeigeschrieben und herbeigeredet werden soll, wird an den Problemen unserer Gesellschaft nichts ändern – ganz im Gegenteil.
Auf der einen Seite der Gesellschaft stehen die urbanen Mittelschichten, also pfiffige Leute, die mehrere Sprachen können, meist gut Geld verdienen und weit gereist sind. Denen sind so Dinge wie die »deutsche Nation« egal, die haben auch kein Problem mit Menschen anderer Hautfarbe oder anderer sexueller Ausrichtung. Auf der anderen Seite der Gesellschaft stehen nach dieser Erzählung die »einfachen Leute«, die kaum aus ihrem Dorf herauskommen, die sich mit »einfacher Arbeit« herumschlagen müssen und die Angst um ihre Jobs haben, die keine Ausländer kennen und von Schwulen verschreckt werden könnten.
Man könnte es auch so sehen: Die coolen Kosmopoliten und die schlichten Malocher kommen nicht miteinander klar. Deshalb wählen die coolen Kosmopoliten eher die »liberalen« Parteien, während die Malocher neuerdings für die AfD und anderen Mist schwärmen.
Es ist eine einfache Erklärung, und wenn man sie schluckt, sieht man die Welt auf einmal viel klarer. Es ist eine Erklärung, die den Rechten dient: Sie können den »einfachen Leuten« erklären, sie würden für sie gegen die Kosmopoliten kämpfen. (Obwohl die AfD-Politikerin Alice Weidel sicher ein perfektes »Role Model« für eine Kosmopolitin abgeben könnte.) Und wer sich selbst zu den Kosmopoliten zählt, kann sich schön von den »Trotteln« abgrenzen und seine Ressentiments pflegen.
Es ist ja nicht so, dass ich eine komplette Theorie für die Probleme dieser Welt anzubieten hätte. Aber dass die Einteilung in Malocher und Kosmopoliten die Welt nicht schöner macht, liegt auf der Hand.
Als ob Menschen aus der Unter- oder Arbeiterklasse dazu verdonnert wären, ausländerfeindlich oder schwulenängstlich zu sein ... Als ob Menschen aus der Mittel- oder Oberschicht automatisch deshalb bessere Menschen wären, weil sie nichts dagegen haben, wenn ein türkischstämmiger Rechtsanwalt oder afrikanisch aussehender Ingenieur im benachbarten Reihenhaus wohnt …
Solidarität ist keine Frage des Geldbeutels, Menschenfeindlichkeit eine Frage von vielen Weltreisen. Der Prozentsatz an Idioten ist in den sozialen Schichten wahrscheinlich recht gleichmäßig verteilt. Und die Trennung in Kosmopoliten und Malocher, wie intellektuell diese auch herbeigeschrieben und herbeigeredet werden soll, wird an den Problemen unserer Gesellschaft nichts ändern – ganz im Gegenteil.
20 Dezember 2018
Ich wage mich an den Kult des Flash
Der Begriff »Kult« hat im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte einen starken Bedeutungswandel durchgemacht. Ich lasse an dieser Stelle aber alle möglichen Gedanken zur Etymologie und Wortentwicklung weg … das hier ist ja kein wissenschaftlicher Blog.
 Sicher aber ist: Was heute als »Kult« bezeichnet wird, muss nicht unbedingt als gut empfunden werden. Es muss vor allem alt sein, und man sollte eine spezielle Bindung zu dem Objekt haben, welches man so bezeichnet. Nur damit ist zu erklären, welche gegensätzlichen Produkte als »Kult« gelten. Was dem einen als »Kult« vorkommt, treibt andere zu Schreien des Entsetzens.
Sicher aber ist: Was heute als »Kult« bezeichnet wird, muss nicht unbedingt als gut empfunden werden. Es muss vor allem alt sein, und man sollte eine spezielle Bindung zu dem Objekt haben, welches man so bezeichnet. Nur damit ist zu erklären, welche gegensätzlichen Produkte als »Kult« gelten. Was dem einen als »Kult« vorkommt, treibt andere zu Schreien des Entsetzens.
Sicher gehört die Science-Fiction-Figur des Flash Gordon dazu. Am Anfang war es ein Comic, der ab 1934 die Fantasien seiner Leser beflügelte, später kamen Romane und vor allem Filme dazu. Die Comics, mit denen Alex Raymond in den 30er- und 40er-Jahre zahlreiche Zeichner beeinflusste, wurden stilprägend und können heute sicher als »Kult« betrachtet werden.
Im Hannibal-Verlag erschien zur Buchmesse ein dickleibiges Buch, das in Form einer Luxus-Edition die Sonntagsseiten der Jahre 1934 bis 1947 präsentiert. Ich habe das Buch daheim, ich habe es auch schon durchgeblättert, und ich habe mir vorgenommen, es über die Feiertage endlich zu lesen. Es sieht toll aus, aber ich habe ein bisschen Angst davor: Was ist, wenn der »Kult« in diesem Fall nur in der Erinnerung funktioniert?
Die »Flash Gordon«-Verfilmung aus dem Jahr 1980 empfand ich – trotz des Ohrwurms von Queen – nicht als »kultig«, sondern eher als »trashig«. Die Comic-Bände aus dem Pollischansky-Verlag konnten mich in den 80er-Jahren nicht begeistern.
Mir ist klar, dass Alex Raymond zu seiner Zeit ein Genie war. Die Zeichnungen sehen immer noch toll aus. Wie sieht es allerdings mit den Texten aus? Funktionieren die Geschichten noch bei mir, sind die etwa noch »Kult« oder finde ich sie peinlich?
Aber gut: Ich lasse mich darauf ein und werde herausfinden, ob sich die Faszination einstellen kann … Bericht folgt!
 Sicher aber ist: Was heute als »Kult« bezeichnet wird, muss nicht unbedingt als gut empfunden werden. Es muss vor allem alt sein, und man sollte eine spezielle Bindung zu dem Objekt haben, welches man so bezeichnet. Nur damit ist zu erklären, welche gegensätzlichen Produkte als »Kult« gelten. Was dem einen als »Kult« vorkommt, treibt andere zu Schreien des Entsetzens.
Sicher aber ist: Was heute als »Kult« bezeichnet wird, muss nicht unbedingt als gut empfunden werden. Es muss vor allem alt sein, und man sollte eine spezielle Bindung zu dem Objekt haben, welches man so bezeichnet. Nur damit ist zu erklären, welche gegensätzlichen Produkte als »Kult« gelten. Was dem einen als »Kult« vorkommt, treibt andere zu Schreien des Entsetzens.Sicher gehört die Science-Fiction-Figur des Flash Gordon dazu. Am Anfang war es ein Comic, der ab 1934 die Fantasien seiner Leser beflügelte, später kamen Romane und vor allem Filme dazu. Die Comics, mit denen Alex Raymond in den 30er- und 40er-Jahre zahlreiche Zeichner beeinflusste, wurden stilprägend und können heute sicher als »Kult« betrachtet werden.
Im Hannibal-Verlag erschien zur Buchmesse ein dickleibiges Buch, das in Form einer Luxus-Edition die Sonntagsseiten der Jahre 1934 bis 1947 präsentiert. Ich habe das Buch daheim, ich habe es auch schon durchgeblättert, und ich habe mir vorgenommen, es über die Feiertage endlich zu lesen. Es sieht toll aus, aber ich habe ein bisschen Angst davor: Was ist, wenn der »Kult« in diesem Fall nur in der Erinnerung funktioniert?
Die »Flash Gordon«-Verfilmung aus dem Jahr 1980 empfand ich – trotz des Ohrwurms von Queen – nicht als »kultig«, sondern eher als »trashig«. Die Comic-Bände aus dem Pollischansky-Verlag konnten mich in den 80er-Jahren nicht begeistern.
Mir ist klar, dass Alex Raymond zu seiner Zeit ein Genie war. Die Zeichnungen sehen immer noch toll aus. Wie sieht es allerdings mit den Texten aus? Funktionieren die Geschichten noch bei mir, sind die etwa noch »Kult« oder finde ich sie peinlich?
Aber gut: Ich lasse mich darauf ein und werde herausfinden, ob sich die Faszination einstellen kann … Bericht folgt!
19 Dezember 2018
Kunst am ZKM
Man muss nicht alles verstehen, was als Kunst im öffentlichen Raum herumsteht. Ich bin manchmal zufrieden damit, wenn es Dinge gibt, die ich gern anschaue und die mir irgendwie imponieren. Wenn ich mich mit dem Rad durch Karlsruhe bewege, sehe ich schließlich genug, das mir seltsam vorkommt. Immer wieder ein Erlebnis ist hier beispielsweise das ZKM, das Zentrum für Kunst und Medien.
 Dort steht neuerdings ein Gebilde – das Fahrrad davor ist nicht meines ... –, das aussieht, als sei es das gestrandete Raumschiff irgendwelcher Außerirdischer aus der Eastside der Galaxis oder als habe man eine besonders faszinierende Ausgrabung unbedingt öffentlich zeigen sollen. Ich finde, das Gebilde wirkt sehr phantastisch, als stamme es von einem Fantasy- oder Science-Fiction-Künstler oder sei die Dekoration aus einem entsprechenden Film.
Dort steht neuerdings ein Gebilde – das Fahrrad davor ist nicht meines ... –, das aussieht, als sei es das gestrandete Raumschiff irgendwelcher Außerirdischer aus der Eastside der Galaxis oder als habe man eine besonders faszinierende Ausgrabung unbedingt öffentlich zeigen sollen. Ich finde, das Gebilde wirkt sehr phantastisch, als stamme es von einem Fantasy- oder Science-Fiction-Künstler oder sei die Dekoration aus einem entsprechenden Film.
Es lässt sich betasten, es fühlt sich interessant an: feine Drähte, irgendein Fiberglas oder dergleichen, schwerelos wirkend auf der einen Seite und stabil aussehend auf der anderen Seite. Für mich als Science-Fiction-Fan ist das immer wieder ein Objekt, zu dem ich hinfahre, um es genauer zu betrachten oder anzufassen. Schön, dass es so etwas gibt!
 Dort steht neuerdings ein Gebilde – das Fahrrad davor ist nicht meines ... –, das aussieht, als sei es das gestrandete Raumschiff irgendwelcher Außerirdischer aus der Eastside der Galaxis oder als habe man eine besonders faszinierende Ausgrabung unbedingt öffentlich zeigen sollen. Ich finde, das Gebilde wirkt sehr phantastisch, als stamme es von einem Fantasy- oder Science-Fiction-Künstler oder sei die Dekoration aus einem entsprechenden Film.
Dort steht neuerdings ein Gebilde – das Fahrrad davor ist nicht meines ... –, das aussieht, als sei es das gestrandete Raumschiff irgendwelcher Außerirdischer aus der Eastside der Galaxis oder als habe man eine besonders faszinierende Ausgrabung unbedingt öffentlich zeigen sollen. Ich finde, das Gebilde wirkt sehr phantastisch, als stamme es von einem Fantasy- oder Science-Fiction-Künstler oder sei die Dekoration aus einem entsprechenden Film.Es lässt sich betasten, es fühlt sich interessant an: feine Drähte, irgendein Fiberglas oder dergleichen, schwerelos wirkend auf der einen Seite und stabil aussehend auf der anderen Seite. Für mich als Science-Fiction-Fan ist das immer wieder ein Objekt, zu dem ich hinfahre, um es genauer zu betrachten oder anzufassen. Schön, dass es so etwas gibt!
18 Dezember 2018
Tanzen an der Pissrinne
»Wie autobiografisch sind deine Geschichten eigentlich?« Als Gelegenheitsautor, der gerne Storys schreibt, die aus der »Ich«-Perspektive erzählen, ist mir diese Frage nicht gerade neu. Bei der aktuellen Folge von »Der gute Geist des Rock'n'Roll« zeigt sich das ganz deutlich. Diese Folge erschien in der neuen Ausgabe des OX-Fanzines, die ein eindrucksvolles Titelbild aufweist, das mich sehr auf den Inhalt neugierig macht.

Im OX 141 ist also die Folge 16 meines Romans zu finden. Der Ich-Erzähler, der zufälligerweise so alt ist wie ich, geht in ein besetztes Haus, in dem abends eine Jungle-Party stattfindet. Im Klo, dessen Pissrinne als spezielles Konstrukt gewürdigt wird, trifft er auf einen tanzenden Mann, mit dem er zu kommunizieren versucht.
Das ist jetzt ein Beispiel für eine Sequenz, die aus der Wirklichkeit stammt. Die Jungle-Party gab es, die Pissrinne war legendär, und ich habe an ihr viele Stunden verbracht. Und natürlich schlugen bei Elektro-Veranstaltungen andere Leute auf als bei Punkrock- oder Hardcore-Konzerten. Aber klar: Alle Dialoge in dieser Folge meines Romans sind erfunden, alle Abläufe entstammen meiner Fantasie.
Noch handelt es sich um einen Roman. Es ist keine Biografie. Auch wenn sich mancher vielleicht in mancher Sequenz wiederzuerkennen glaubt …

Im OX 141 ist also die Folge 16 meines Romans zu finden. Der Ich-Erzähler, der zufälligerweise so alt ist wie ich, geht in ein besetztes Haus, in dem abends eine Jungle-Party stattfindet. Im Klo, dessen Pissrinne als spezielles Konstrukt gewürdigt wird, trifft er auf einen tanzenden Mann, mit dem er zu kommunizieren versucht.
Das ist jetzt ein Beispiel für eine Sequenz, die aus der Wirklichkeit stammt. Die Jungle-Party gab es, die Pissrinne war legendär, und ich habe an ihr viele Stunden verbracht. Und natürlich schlugen bei Elektro-Veranstaltungen andere Leute auf als bei Punkrock- oder Hardcore-Konzerten. Aber klar: Alle Dialoge in dieser Folge meines Romans sind erfunden, alle Abläufe entstammen meiner Fantasie.
Noch handelt es sich um einen Roman. Es ist keine Biografie. Auch wenn sich mancher vielleicht in mancher Sequenz wiederzuerkennen glaubt …
17 Dezember 2018
Denkmal für kämpfende Frauen
Im deutschsprachigen Raum ist der Aufstand der Pariser Kommune kein sonderlich wichtiges Thema. Ich erinnere mich nicht daran, das Thema jemals im Mainstream der großen Medien gesehen zu haben, kenne das Thema nur aus Büchern oder seltenen Artikeln in eher links stehenden Zeitschriften. In Frankreich ist das ein anderes Thema.
In drei Alben nimmt sich der französische Comic-Autor Wilfrid Lupano – unter anderem bekannt durch seine »Alten Knacker« – des Themas an. Er erzählt vom Aufstand der Bürger, von den Kämpfen auf den Barrikaden. Doch er zeigt diese Kämpfe aus der Sicht der Frauen. Allein schon aus diesem Grund ist die Trilogie »Auf die Barrikaden!« besonders eindrucksvoll.
Der erste Band trägt den Titel »Der Aufstand der Frauen« und stellt eine russische Revolutionärin ins Zentrum der Geschichte. Die junge Frau möchte aktiv am Kampf teilnehmen, nicht nur den Männern das Essen bringen. Sie ist klug und attraktiv, und sie bringt mit ihrem forschen Vorgehen nicht nur die Revolutionäre, sondern auch die Kräfte der Reaktion durcheinander.
Lupano erzählt seine Geschichte mit politischem Interesse, aber auch mit Witz. Als Leser kann man immer wieder schmunzeln, trotz der dramatischen Geschehnisse, die ja – wie man aus der Geschichte wissen kann – mit einer Niederlage für die Revolution enden. Seine Heldin ist tatkräftig und unglaublich mutig, man wünscht ihr als Leser jeglichen Erfolg.
Unterstützt wird die Geschichte durch die starken Bilder, die Anthony Jean beisteuert. Sie schwanken zwischen knallhartem Realismus und augenzwinkerndem Humor, setzen die Situation im belagerten Paris des Jahres 1871 eindrucksvoll in Szene.
Mit »Der Aufstand der Frauen« ist den beiden Comic-Kreativen ein Comic-Album gelungen, das feministischen Elan mit einer packenden Handlung und einer tollen Grafik verbindet, eine mitreißende Geschichte, die historische Elemente mit originellen Dialogen präsentiert. Meine absolute Empfehlung an dieser Stelle! (Checkt die Leseprobe auf der Internet-Seite des Splitter-Verlages!)
In drei Alben nimmt sich der französische Comic-Autor Wilfrid Lupano – unter anderem bekannt durch seine »Alten Knacker« – des Themas an. Er erzählt vom Aufstand der Bürger, von den Kämpfen auf den Barrikaden. Doch er zeigt diese Kämpfe aus der Sicht der Frauen. Allein schon aus diesem Grund ist die Trilogie »Auf die Barrikaden!« besonders eindrucksvoll.
Der erste Band trägt den Titel »Der Aufstand der Frauen« und stellt eine russische Revolutionärin ins Zentrum der Geschichte. Die junge Frau möchte aktiv am Kampf teilnehmen, nicht nur den Männern das Essen bringen. Sie ist klug und attraktiv, und sie bringt mit ihrem forschen Vorgehen nicht nur die Revolutionäre, sondern auch die Kräfte der Reaktion durcheinander.
Lupano erzählt seine Geschichte mit politischem Interesse, aber auch mit Witz. Als Leser kann man immer wieder schmunzeln, trotz der dramatischen Geschehnisse, die ja – wie man aus der Geschichte wissen kann – mit einer Niederlage für die Revolution enden. Seine Heldin ist tatkräftig und unglaublich mutig, man wünscht ihr als Leser jeglichen Erfolg.
Unterstützt wird die Geschichte durch die starken Bilder, die Anthony Jean beisteuert. Sie schwanken zwischen knallhartem Realismus und augenzwinkerndem Humor, setzen die Situation im belagerten Paris des Jahres 1871 eindrucksvoll in Szene.
Mit »Der Aufstand der Frauen« ist den beiden Comic-Kreativen ein Comic-Album gelungen, das feministischen Elan mit einer packenden Handlung und einer tollen Grafik verbindet, eine mitreißende Geschichte, die historische Elemente mit originellen Dialogen präsentiert. Meine absolute Empfehlung an dieser Stelle! (Checkt die Leseprobe auf der Internet-Seite des Splitter-Verlages!)
Ein Hörspiel als Doppel-LP
Unabhängig vom Hörspiel und seinen inhaltlichen Qualitäten: Mit der Doppel-Langspielplatte zu »Dorian Hunter 33« hat mich Zaubermond Audio absolut positiv überrascht. So kann und muss man eine Vinylscheibe in unseren Zeiten aufmachen, damit sie einen begeistert und zum Kauf anreizt.

Der Grund dafür ist, dass bei dem Hörspiel »Kirkwall Paradise« eine Reihe von Youtubern als Sprecher eingesetzt worden sind. Um dieses Ereignis zu feiern, hat das Label sich und den Macher/innen eine tolle Produktion präsentiert.
Es entstand ein prachtvolles Cover, eine beeindruckende Albumhülle, die man aufklappen kann und die auf ihrer Innenseite schöne Informationen und Fotos liefert. Auch die »Innenteile« überzeugen: Jede Hülle für die zwei LP-Scheiben, die im Album-Cover stecken, ist vierfarbig bedruckt.
Das sollte sogar für Menschen, die keine Fans von »Dorian Hunter« sind, ein Grund sein, die Platte zumindest mal anzuchecken. Was für eine großartige Optik!
(Wer sich jetzt wundert, dass ich nichts zum Inhalt schreibe. Das folgt noch. Aber hier und heute geht es darum, dass ich mich öffentlich darüber freue, dass jemand in diesem Jahrzehnt ein Hörspiel in dieser Form veröffentlicht. Großartig!)
Ach ja: Die Platte ist auf 500 Exemplare limitiert. Man bekommt sie derzeit im Shop von Zaubermond zu einem reduzierten Preis. Ich finde, da sollte man zuschlagen!

Der Grund dafür ist, dass bei dem Hörspiel »Kirkwall Paradise« eine Reihe von Youtubern als Sprecher eingesetzt worden sind. Um dieses Ereignis zu feiern, hat das Label sich und den Macher/innen eine tolle Produktion präsentiert.
Es entstand ein prachtvolles Cover, eine beeindruckende Albumhülle, die man aufklappen kann und die auf ihrer Innenseite schöne Informationen und Fotos liefert. Auch die »Innenteile« überzeugen: Jede Hülle für die zwei LP-Scheiben, die im Album-Cover stecken, ist vierfarbig bedruckt.
Das sollte sogar für Menschen, die keine Fans von »Dorian Hunter« sind, ein Grund sein, die Platte zumindest mal anzuchecken. Was für eine großartige Optik!
(Wer sich jetzt wundert, dass ich nichts zum Inhalt schreibe. Das folgt noch. Aber hier und heute geht es darum, dass ich mich öffentlich darüber freue, dass jemand in diesem Jahrzehnt ein Hörspiel in dieser Form veröffentlicht. Großartig!)
Ach ja: Die Platte ist auf 500 Exemplare limitiert. Man bekommt sie derzeit im Shop von Zaubermond zu einem reduzierten Preis. Ich finde, da sollte man zuschlagen!
16 Dezember 2018
Geschwätz mit Nazis?
Das ganze Jahr 2018 musste ich mir immer wieder anhören oder es irgendwie lesen: Man solle mit den Rechtsradikalen reden, man sollte ihnen zuhören und sie ernstnehmen. Ihre Anliegen seien grundsätzlich nachvollziehbar, ihre Methoden falsch. Und ich sagte in solchen Fällen stets, dass ich keine Lust auf solche Gespräche habe.
Das hat sich nicht geändert, und ich fürchte, meine Sicht der Dinge werde ich auch 2019 nicht verändern. Es ist nicht sinnvoll, mit Nazis oder mit »Rechten« zu reden, und ich habe weder Lust noch Zeit, mit diesen Leuten meine Lebenszeit zu verschwenden. (Ich weiß: Man könnte sie ja bekehren. Aber daran glaube ich derzeit nicht.)
Wie soll ich mir das denn vorstellen? Wir setzen uns zusammen, wir trinken Kräutertee, und dann reden wir. Über Flüchtlinge und »Musels«, sicher nicht über Straßenbau und Umweltschutz. Über Messerangriffe und Vergewaltigungen von Ausländern, sicher aber nicht von einer Kultur, in der es sinnvoll ist, Einflüsse von außen zu verarbeiten.
Selbst wenn es gut laufen sollte: Im besten Fall haut man sich die Ansichten um die Ohren, bleibt dabei höflich und freundlich, vergreift sich nicht im Ton und geht hinterher auseinander, ohne dass sich etwas ändert. Wahrscheinlicher ist doch, dass man sich eben nicht »human« verhält, sondern sich sinnlos streitet.
Es geht mir schon gar nicht mehr um Richtig und Falsch. Es geht mir darum, dass ich es als Verschwendung von Lebenszeit betrachte, mit Menschen zu reden, die – sobald sie an die Macht kämen – Leute wie mich in ein Lager stecken würden. Und da lasse ich mich gern als intolerant beschimpfen ...
Das hat sich nicht geändert, und ich fürchte, meine Sicht der Dinge werde ich auch 2019 nicht verändern. Es ist nicht sinnvoll, mit Nazis oder mit »Rechten« zu reden, und ich habe weder Lust noch Zeit, mit diesen Leuten meine Lebenszeit zu verschwenden. (Ich weiß: Man könnte sie ja bekehren. Aber daran glaube ich derzeit nicht.)
Wie soll ich mir das denn vorstellen? Wir setzen uns zusammen, wir trinken Kräutertee, und dann reden wir. Über Flüchtlinge und »Musels«, sicher nicht über Straßenbau und Umweltschutz. Über Messerangriffe und Vergewaltigungen von Ausländern, sicher aber nicht von einer Kultur, in der es sinnvoll ist, Einflüsse von außen zu verarbeiten.
Selbst wenn es gut laufen sollte: Im besten Fall haut man sich die Ansichten um die Ohren, bleibt dabei höflich und freundlich, vergreift sich nicht im Ton und geht hinterher auseinander, ohne dass sich etwas ändert. Wahrscheinlicher ist doch, dass man sich eben nicht »human« verhält, sondern sich sinnlos streitet.
Es geht mir schon gar nicht mehr um Richtig und Falsch. Es geht mir darum, dass ich es als Verschwendung von Lebenszeit betrachte, mit Menschen zu reden, die – sobald sie an die Macht kämen – Leute wie mich in ein Lager stecken würden. Und da lasse ich mich gern als intolerant beschimpfen ...
15 Dezember 2018
Aus für das »Weinkontor«
An diesem Wochenende schließt das »Weinkontor« in Landau seine Pforten. Ich finde das traurig, mir fehlen fast die Worte. Auf der Internet-Seite geben die Betreiber dazu bekannt: »Wir bedanken uns herzlich und mit Tränen in den Augen bei unseren langjährigen Stammgästen und unseren leibgewonnen Winzerfreunden.«
Als wir am vergangenen Wochenende noch einmal im »Weinkontor« waren, bekamen wir – wie immer – ein tolles Essen serviert, dazu wunderbare Weine, in einer Atmosphäre, die ich stets als positiv und aufmerksam empfand. Ich hatte zum wiederholten Mal das Gefühl, in Corine Berrevoets und Michael Mury nicht nur ein Restaurant-Team, sondern echte Gastgeber zu treffen.
Bereits zum Jahresanfang hatten sich die beiden in einem Artikel in der »Rheinpfalz« dazu geäußert, zum Ende des Jahres 2018 aufhören zu wollen. Die Lage in der Gastronomie sei schwierig, das Ganze sei – wenn man ein gewisses Niveau wolle – »wirtschaftlich für zwei Familien nicht darstellbar«.
Ich kann das alles nicht beurteilen. Ich kenne weder die Kalkulation eines solchen Lokals, noch kann ich den Aufwand einschätzen. Ich fand das Preis-Leistungs-Verhältnis immer hervorragend, ich mochte das Essen, die Weine und die Gastfreundschaft. Und ich werde auch die einen oder andere Träne in Erinnerung an das »Weinkontor« vergießen.
Als wir am vergangenen Wochenende noch einmal im »Weinkontor« waren, bekamen wir – wie immer – ein tolles Essen serviert, dazu wunderbare Weine, in einer Atmosphäre, die ich stets als positiv und aufmerksam empfand. Ich hatte zum wiederholten Mal das Gefühl, in Corine Berrevoets und Michael Mury nicht nur ein Restaurant-Team, sondern echte Gastgeber zu treffen.
Bereits zum Jahresanfang hatten sich die beiden in einem Artikel in der »Rheinpfalz« dazu geäußert, zum Ende des Jahres 2018 aufhören zu wollen. Die Lage in der Gastronomie sei schwierig, das Ganze sei – wenn man ein gewisses Niveau wolle – »wirtschaftlich für zwei Familien nicht darstellbar«.
Ich kann das alles nicht beurteilen. Ich kenne weder die Kalkulation eines solchen Lokals, noch kann ich den Aufwand einschätzen. Ich fand das Preis-Leistungs-Verhältnis immer hervorragend, ich mochte das Essen, die Weine und die Gastfreundschaft. Und ich werde auch die einen oder andere Träne in Erinnerung an das »Weinkontor« vergießen.
14 Dezember 2018
»Besuch bei Papa« noch mal geprüft
Die Kurzgeschichte »Besuch bei Papa« entstand, nachdem ich zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Voudou-Markt gewesen war. Ich schrieb sie am 30. Januar 1988 in Avepozo, wo ich in einer Hütte wohnte. In Togo faszinierte mich die Allgegenwärtigkeit von Voudou, an dem niemand zweifelte. Ich sah immer wieder am Strand oder wenn ich mit meinem Rad unterwegs war, die Reste von Zeremonien.
Die Geschichte schrieb ich in einem Rausch auf Notizblätter. Ich tippte sie erst Jahre später ab, als ich in Bischweier wohnte und bereits in Rastatt arbeitete – am 30. Juli 1994 war ich damit fertig.
Danach war ich ein wenig ratlos: War das jetzt eine Reisegeschichte, konnte man sie als »phantastisch« betrachten, war das vielleicht sogar Horror? Ich wusste es nicht, es war auch egal.
Veröffentlicht wurde sie 1996 in der Ausgabe 6 des Fanzines »Sternenfeuer«, das unter anderem von Klaus Bollhöfener herausgegeben wurde. Das Fanzine hatte eine geringe Auflage, es gab einige Resonanzen auf die Geschichte, dann geriet sie in Vergessenheit. Auch bei mir.
Im Dezember 2018 hielt ich sie wieder in den Händen, stellte sie auf neue Rechtschreibung um und entfernte das eine oder andere Wort, das mir nicht mehr gefiel. Insgesamt aber fand ich die Geschichte immer noch gut – und ich stellte mir die Frage, was ich damit machen sollte. Schauen wir mal ...
Die Geschichte schrieb ich in einem Rausch auf Notizblätter. Ich tippte sie erst Jahre später ab, als ich in Bischweier wohnte und bereits in Rastatt arbeitete – am 30. Juli 1994 war ich damit fertig.
Danach war ich ein wenig ratlos: War das jetzt eine Reisegeschichte, konnte man sie als »phantastisch« betrachten, war das vielleicht sogar Horror? Ich wusste es nicht, es war auch egal.
Veröffentlicht wurde sie 1996 in der Ausgabe 6 des Fanzines »Sternenfeuer«, das unter anderem von Klaus Bollhöfener herausgegeben wurde. Das Fanzine hatte eine geringe Auflage, es gab einige Resonanzen auf die Geschichte, dann geriet sie in Vergessenheit. Auch bei mir.
Im Dezember 2018 hielt ich sie wieder in den Händen, stellte sie auf neue Rechtschreibung um und entfernte das eine oder andere Wort, das mir nicht mehr gefiel. Insgesamt aber fand ich die Geschichte immer noch gut – und ich stellte mir die Frage, was ich damit machen sollte. Schauen wir mal ...
Labels:
Afrika,
Erinnerungen,
Literatur,
Veröffentlichungen
13 Dezember 2018
Der Kosmosgigant wirbt
Science Fiction war in den 70er-Jahren eine »Jungs-Literatur«, und in der Fan-Szene bewegten sich vor allem männliche Jugendliche und einige wenige junge Männer. Deshalb verwundert es auch kaum, dass Fanzines immer wieder sexistische Inhalte brachten oder mit »nackten Mädchen« warben – manche fanden Darstellungen von Nacktheit geradezu progressiv.
Ein schönes Beispiel ist das Fanzine »Giant Of Cosmos«, das gegen Ende der 70er- und zum Anfang der 80er-Jahre vor allem mit gesellschaftskritischen Inhalten auffiel. Man war bewusst »links«; wenn ich mich recht erinnere, zählten der Herausgeber und seine Freunde zu jener Zeit zum DKP-Umfeld. Heute kann man sich das kaum noch vorstellen, aber in diesen Jahren galt die DKP zwar als ein bisschen spinnert, aber sonst als durchaus demokratisch und korrekt.
Mit »Weltraum-Western-Stories«, von denen sich die Herausgeber distanzieren wollten, war vor allem eine erfolgreiche Science-Fiction-Heftromanserie gemeint, deren Lesern gern actionlastige Geschichten schrieben. Wer eher Sozialkritik veröffentlichen wollte, hatte aus nachvollziehbaren Gründen wenig Lust auf Kämpfe zwischen Raumschiffen und deren Besatzungen.
Durchaus üblich war übrigens, dass die »normalen« Seiten eines solchen Fanzines mit einem Umdrucker hergestellt wurden und man die Grafiken via Offsetdruck präsentierte. Man musste beim Zusammenlegen der Seiten entsprechend aufpassen. Das Ergebnis war manchmal gut, manchmal schrecklich.
Sieht man von der seltsamen Werbung ab, die ich 1980 übrigens keine Sekunde lang seltsam fand, erinnere ich mich an den »Giant Of Cosmos« sehr positiv. Die politischen Inhalte hielten sich in Grenzen, das Fanzine lieferte eine schöne Mischung aus Geschichten, Buchbesprechungen und Artikeln. Manchmal fehlen mir solche Hefte, die bewusst politisch argumentierten, in der heutigen Phantastik-Szene.
Ein schönes Beispiel ist das Fanzine »Giant Of Cosmos«, das gegen Ende der 70er- und zum Anfang der 80er-Jahre vor allem mit gesellschaftskritischen Inhalten auffiel. Man war bewusst »links«; wenn ich mich recht erinnere, zählten der Herausgeber und seine Freunde zu jener Zeit zum DKP-Umfeld. Heute kann man sich das kaum noch vorstellen, aber in diesen Jahren galt die DKP zwar als ein bisschen spinnert, aber sonst als durchaus demokratisch und korrekt.
Mit »Weltraum-Western-Stories«, von denen sich die Herausgeber distanzieren wollten, war vor allem eine erfolgreiche Science-Fiction-Heftromanserie gemeint, deren Lesern gern actionlastige Geschichten schrieben. Wer eher Sozialkritik veröffentlichen wollte, hatte aus nachvollziehbaren Gründen wenig Lust auf Kämpfe zwischen Raumschiffen und deren Besatzungen.
Durchaus üblich war übrigens, dass die »normalen« Seiten eines solchen Fanzines mit einem Umdrucker hergestellt wurden und man die Grafiken via Offsetdruck präsentierte. Man musste beim Zusammenlegen der Seiten entsprechend aufpassen. Das Ergebnis war manchmal gut, manchmal schrecklich.
Sieht man von der seltsamen Werbung ab, die ich 1980 übrigens keine Sekunde lang seltsam fand, erinnere ich mich an den »Giant Of Cosmos« sehr positiv. Die politischen Inhalte hielten sich in Grenzen, das Fanzine lieferte eine schöne Mischung aus Geschichten, Buchbesprechungen und Artikeln. Manchmal fehlen mir solche Hefte, die bewusst politisch argumentierten, in der heutigen Phantastik-Szene.
12 Dezember 2018
Literaturen aus anderen Weltgegenden
Schaue ich beispielsweise während der Buchmesse in die Literaturbeilagen der großen Tageszeitungen, lese ich mal das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen oder gucke ich eine Folge des Literarischen Quartetts an, so stelle ich immer wieder fest: Der größte Teil der sogenannten anspruchsvollen Literatur, die einem in solchen Medien um die Ohren gehauen oder vorgeschlagen wird, klingt schon so langweilig, dass ich nicht die geringste Lust habe, da auch nur die Leseprobe anzufassen.
 Dann aber bringt die »taz« eine Sondereilage von »Litprom«, die sich »Literatur Nachrichten« nennt, und ich stelle nicht nur fest, dass ich sie komplett lese, sondern dass ich sogar tierisch Lust darauf bekomme, die vorgestellten Romane alle zu lesen. Präsentiert werden Autorinnen und Autoren aus den unterschiedlichsten Weltgegenden, aus Südamerika und Afrika in diesem Fall, die eben Krimis schreiben. Das klingt spannend und abwechslungsreich, das macht mich alles neugierig.
Dann aber bringt die »taz« eine Sondereilage von »Litprom«, die sich »Literatur Nachrichten« nennt, und ich stelle nicht nur fest, dass ich sie komplett lese, sondern dass ich sogar tierisch Lust darauf bekomme, die vorgestellten Romane alle zu lesen. Präsentiert werden Autorinnen und Autoren aus den unterschiedlichsten Weltgegenden, aus Südamerika und Afrika in diesem Fall, die eben Krimis schreiben. Das klingt spannend und abwechslungsreich, das macht mich alles neugierig.
Wann immer ich diese »Literatur Nachrichten« in den Händen halte, kaufe ich danach Bücher von Schreibenden, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Das finde ich toll. Die aktuelle Ausgabe bestätigt das. (Man kann sie übrigens auf der Litprom-Seite im Internet herunterladen.)
Dass ich dem Verein – ein Litprom e.V. steht dahinter, der sich der »Vermittlung außereuropäischer Literaturen« verschrieben hat – nicht beitreten werde, obwohl ich das alles interessant finde, hat einen einfachen Grund: Selbstschutz. Ich würde sonst noch mehr Bücher kaufen, die sich dann in irgendwelchen Stapeln verbergen werden ...
 Dann aber bringt die »taz« eine Sondereilage von »Litprom«, die sich »Literatur Nachrichten« nennt, und ich stelle nicht nur fest, dass ich sie komplett lese, sondern dass ich sogar tierisch Lust darauf bekomme, die vorgestellten Romane alle zu lesen. Präsentiert werden Autorinnen und Autoren aus den unterschiedlichsten Weltgegenden, aus Südamerika und Afrika in diesem Fall, die eben Krimis schreiben. Das klingt spannend und abwechslungsreich, das macht mich alles neugierig.
Dann aber bringt die »taz« eine Sondereilage von »Litprom«, die sich »Literatur Nachrichten« nennt, und ich stelle nicht nur fest, dass ich sie komplett lese, sondern dass ich sogar tierisch Lust darauf bekomme, die vorgestellten Romane alle zu lesen. Präsentiert werden Autorinnen und Autoren aus den unterschiedlichsten Weltgegenden, aus Südamerika und Afrika in diesem Fall, die eben Krimis schreiben. Das klingt spannend und abwechslungsreich, das macht mich alles neugierig.Wann immer ich diese »Literatur Nachrichten« in den Händen halte, kaufe ich danach Bücher von Schreibenden, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Das finde ich toll. Die aktuelle Ausgabe bestätigt das. (Man kann sie übrigens auf der Litprom-Seite im Internet herunterladen.)
Dass ich dem Verein – ein Litprom e.V. steht dahinter, der sich der »Vermittlung außereuropäischer Literaturen« verschrieben hat – nicht beitreten werde, obwohl ich das alles interessant finde, hat einen einfachen Grund: Selbstschutz. Ich würde sonst noch mehr Bücher kaufen, die sich dann in irgendwelchen Stapeln verbergen werden ...
11 Dezember 2018
Ein Gruselhörspiel ohne Monster und Dämonen
In der immer umfangreicher werdenden Hörspielserie um den Geisterjäger John Sinclair nimmt »Melinas Mordgespenster« eine besondere Rolle ein. Das Doppelhörspiel kommt nämlich ohne übernatürliche Feinde aus, sondern ist – für die Serie vor allem – erstaunlich psychologisch und dadurch ziemlich spannend.
 Der Roman wurde erstmals 1981 veröffentlicht; damals als Band 177 der Serie. Zur Story: Der Geisterjäger wird von seinen Eltern gewissermaßen in sein Heimatdorf zurückbeordert. Dort seien Menschen auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Während seiner Fahrt ins Dorf trifft Sinclair mit einem seltsamen Mädchen zusammen, das ihn zu attackieren versucht, dann aber verschwindet. Etwas ist unheimlich in diesem Dorf, das scheint zu stimmen ...
Der Roman wurde erstmals 1981 veröffentlicht; damals als Band 177 der Serie. Zur Story: Der Geisterjäger wird von seinen Eltern gewissermaßen in sein Heimatdorf zurückbeordert. Dort seien Menschen auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Während seiner Fahrt ins Dorf trifft Sinclair mit einem seltsamen Mädchen zusammen, das ihn zu attackieren versucht, dann aber verschwindet. Etwas ist unheimlich in diesem Dorf, das scheint zu stimmen ...
»Melinas Mordgespenster« erzählt von zwei Mädchen, deren Vater offenbar vor ihren Augen ermordet worden ist. Das haben beide nicht verkraftet. Während die eine in eine »Anstalt« eingeliefert werden musste, wohnt die andere mit ihrer Mutter zusammen – und diese arbeitet interessanterweise als Haushaltshilfe bei den Eltern von John Sinclair.
Familiäre Verwicklungen kommen hier ebenso zusammen wie fürchterliche Mordtaten, verzweifelte Mädchen und eine psychiatrische Einrichtung, die nicht sehr vertrauensbildend wirkt. Die Doppel-CD setzt auf die Schock-Effekte, die man bei den anderen »Sinclair«-Hörspielen schon kennt. Wenn gemordet wird, hört man das Zustechen ebenso wie das Spritzen des Blutes. Wer das nicht zu schockierend findet, bekommt eine spannende Hörspiel-Doppelfolge geliefert, die durch eine höhere Realitätsnähe überzeugt.
Klar, anspruchsvolle Psychologie wird nicht geboten; die Geschichte ist für einen »Sinclair« trotzdem gut geworden. Streckenweise wird sie ruhig erzählt, weshalb die Knaller umso heftiger wirken. Gute Dialoge, sehr gute Sprecher, sorgsam eingesetzte Geräusche – wer ein gruseliges Hörspiel mag, ist hier richtig.
Übrigens hat Lübbe-Audio das Hörspiel schön gestaltet: Diesmal werden die zwei CDs in einem Pappschuber ausgeliefert. Wer sich nur den Download sichert, hat dieses haptische Vergnügen allerdings nicht ... (Ach ja: Wer sich mal einen Eindruck verschaffen möchte, checke die Internet-Seite des Verlages.)
 Der Roman wurde erstmals 1981 veröffentlicht; damals als Band 177 der Serie. Zur Story: Der Geisterjäger wird von seinen Eltern gewissermaßen in sein Heimatdorf zurückbeordert. Dort seien Menschen auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Während seiner Fahrt ins Dorf trifft Sinclair mit einem seltsamen Mädchen zusammen, das ihn zu attackieren versucht, dann aber verschwindet. Etwas ist unheimlich in diesem Dorf, das scheint zu stimmen ...
Der Roman wurde erstmals 1981 veröffentlicht; damals als Band 177 der Serie. Zur Story: Der Geisterjäger wird von seinen Eltern gewissermaßen in sein Heimatdorf zurückbeordert. Dort seien Menschen auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Während seiner Fahrt ins Dorf trifft Sinclair mit einem seltsamen Mädchen zusammen, das ihn zu attackieren versucht, dann aber verschwindet. Etwas ist unheimlich in diesem Dorf, das scheint zu stimmen ...»Melinas Mordgespenster« erzählt von zwei Mädchen, deren Vater offenbar vor ihren Augen ermordet worden ist. Das haben beide nicht verkraftet. Während die eine in eine »Anstalt« eingeliefert werden musste, wohnt die andere mit ihrer Mutter zusammen – und diese arbeitet interessanterweise als Haushaltshilfe bei den Eltern von John Sinclair.
Familiäre Verwicklungen kommen hier ebenso zusammen wie fürchterliche Mordtaten, verzweifelte Mädchen und eine psychiatrische Einrichtung, die nicht sehr vertrauensbildend wirkt. Die Doppel-CD setzt auf die Schock-Effekte, die man bei den anderen »Sinclair«-Hörspielen schon kennt. Wenn gemordet wird, hört man das Zustechen ebenso wie das Spritzen des Blutes. Wer das nicht zu schockierend findet, bekommt eine spannende Hörspiel-Doppelfolge geliefert, die durch eine höhere Realitätsnähe überzeugt.
Klar, anspruchsvolle Psychologie wird nicht geboten; die Geschichte ist für einen »Sinclair« trotzdem gut geworden. Streckenweise wird sie ruhig erzählt, weshalb die Knaller umso heftiger wirken. Gute Dialoge, sehr gute Sprecher, sorgsam eingesetzte Geräusche – wer ein gruseliges Hörspiel mag, ist hier richtig.
Übrigens hat Lübbe-Audio das Hörspiel schön gestaltet: Diesmal werden die zwei CDs in einem Pappschuber ausgeliefert. Wer sich nur den Download sichert, hat dieses haptische Vergnügen allerdings nicht ... (Ach ja: Wer sich mal einen Eindruck verschaffen möchte, checke die Internet-Seite des Verlages.)
Komintern Sect von 1983
Auch wenn ich mich in den 80er-Jahren nicht gerade mit Punkrock aus Frankreich auskannte – die Band Komintern Sect war mir ein Begriff. Die vier Punks und Skins aus Orléans spielten in der ersten Hälfte der 80er-Jahre zusammen, lösten sich 1986 auf und gaben in den Nullerjahren dann doch mal wieder einige Konzerte. Die wichtigste Zeit der Band war aber eindeutig von 1983 bis 1986.

Neben vielen Aufnahmen für klassische Sampler wie etwa »Chaos en France« (nach dieser Sampler-Reihe benannte ich übrigens meinen Punkrock-Roman »Chaos en France – Peter Pank in Avignon«) veröffentlichte die Band auch drei Platten. Die erste LP mit dem klaren Titel »Le seigneurs de la guerre« kam 1983 heraus und kann heute noch überzeugen.
Klar ist der Punkrock nicht gerade schnell, und er rumpelt ganz schön. Dafür gefallen die Oi!-Chöre und die klare Haltung. Die Band war zu ihrer Zeit dem klassischen Stil verhaftet und hielt nicht viel von dem damals neuen Hardcore-Punk; das macht ihre Platte zeitloser als manches Gebretter, das zur selben Zeit von der Insel kam.
Textlich ist und war die Band eher schlicht, dafür aber eindeutig. Obwohl man Oi! mochte, hielt man sich von den Rechten fern. In Stücken wie »Barcelone 1936« oder auch dem Titelstück der Platte behandelt die Band zeitlose Themen: Es geht um Krieg und Freiheit oder um das Leben des einzelnen in einer kälter werdenden Gesellschaft und andere Dinge.
Klar: Die Platte ist vor allem ein zeitgenössisches Dokument. Ich war 1983 zum ersten Mal in Paris und fand die Mischung aus Tristesse in manchen heruntergekommenen Straßenzügen sowie der historischen Tradition dieser Metropole immer irritierend. Komintern Sect lieferte den passenden Soundtrack dazu.

Neben vielen Aufnahmen für klassische Sampler wie etwa »Chaos en France« (nach dieser Sampler-Reihe benannte ich übrigens meinen Punkrock-Roman »Chaos en France – Peter Pank in Avignon«) veröffentlichte die Band auch drei Platten. Die erste LP mit dem klaren Titel »Le seigneurs de la guerre« kam 1983 heraus und kann heute noch überzeugen.
Klar ist der Punkrock nicht gerade schnell, und er rumpelt ganz schön. Dafür gefallen die Oi!-Chöre und die klare Haltung. Die Band war zu ihrer Zeit dem klassischen Stil verhaftet und hielt nicht viel von dem damals neuen Hardcore-Punk; das macht ihre Platte zeitloser als manches Gebretter, das zur selben Zeit von der Insel kam.
Textlich ist und war die Band eher schlicht, dafür aber eindeutig. Obwohl man Oi! mochte, hielt man sich von den Rechten fern. In Stücken wie »Barcelone 1936« oder auch dem Titelstück der Platte behandelt die Band zeitlose Themen: Es geht um Krieg und Freiheit oder um das Leben des einzelnen in einer kälter werdenden Gesellschaft und andere Dinge.
Klar: Die Platte ist vor allem ein zeitgenössisches Dokument. Ich war 1983 zum ersten Mal in Paris und fand die Mischung aus Tristesse in manchen heruntergekommenen Straßenzügen sowie der historischen Tradition dieser Metropole immer irritierend. Komintern Sect lieferte den passenden Soundtrack dazu.
10 Dezember 2018
An die Buzzcocks denken
Zu den Bands, die ich seit gut vierzig Jahren mag und immer wieder gern höre, zählen die Buzzcocks. Ich habe mehrere Platten der Band, allerdings allesamt Nachpressungen, die für Sammler keine große Relevanz habe, und höre mir diese immer wieder an, habe aber auch keine Skrupel, bei YouTube nach Aufnahmen der Band zu schauen und diese während der Arbeitszeit laufen zu lassen.
Dass Pete Shelley, der Sänger der Band, am 6. Dezember im Alter von nur 63 Jahren starb, überraschte mich dann doch. Mir fiel sofort wieder das einzige Konzert der Band ein, das ich in meinem ganzen Leben gesehen hatte. Ich musste in meinen Notizen nachschauen, um herauszufinden, wann das gewesen war.
Am Donnerstag, 18. Mai 2000, fuhr ich nach Weinheim ins Café Central, wo ich an diesem Abend für drei Bands meinen Eintritt bezahlte, dann gleich mal zwei Bands völlig verschwatzte, um dann zu den Buzzcocks in den Konzertraum zu gehen. Ich war durchaus skeptisch, daran erinnere ich mich noch gut. Immerhin waren die großen Zeiten der Band damals ja eigentlich schon zwanzig Jahre vorbei.
Aber dann war ich völlig baff. Auf der Bühne standen einige ältere Herren – man muss sich klar machen, dass die damals jünger waren als ich heute … –, und nach einiger Zeit merkte ich, dass die offenbar richtig viel Freude hatten. Sie grinsten die ganze Zeit, sie pfefferten ihre alten Hits mit großartiger Energie ins Publikum. Von »langsam« und »alt« konnte keine Frage sein; die sahen auch genauso aus wie früher (na ja, die paar Falten erkannte ich einfach nicht).
Sie spielten natürlich alle großen Hits wie »Orgasm Addict« oder »Harmony In My Head« – mein Lieblingsstück dieser Band – und natürlich der Über-Hit »Ever Fallen In Love«. Und irgendwann konnte ich nicht mehr still stehen und mit dem Fuß wippen, sondern fing an, wie ein Teenager herumzuhüpfen. Ich sprang, ich sang, ich lachte, ich freute mich.
So habe ich die Band in Erinnerung, und wenn ich die alten Stücke der Buzzcocks anhöre, denke ich an dieses Konzert. Dass Pete Shelley jetzt gestorben ist, trifft mich tatsächlich.
Dass Pete Shelley, der Sänger der Band, am 6. Dezember im Alter von nur 63 Jahren starb, überraschte mich dann doch. Mir fiel sofort wieder das einzige Konzert der Band ein, das ich in meinem ganzen Leben gesehen hatte. Ich musste in meinen Notizen nachschauen, um herauszufinden, wann das gewesen war.
Am Donnerstag, 18. Mai 2000, fuhr ich nach Weinheim ins Café Central, wo ich an diesem Abend für drei Bands meinen Eintritt bezahlte, dann gleich mal zwei Bands völlig verschwatzte, um dann zu den Buzzcocks in den Konzertraum zu gehen. Ich war durchaus skeptisch, daran erinnere ich mich noch gut. Immerhin waren die großen Zeiten der Band damals ja eigentlich schon zwanzig Jahre vorbei.
Aber dann war ich völlig baff. Auf der Bühne standen einige ältere Herren – man muss sich klar machen, dass die damals jünger waren als ich heute … –, und nach einiger Zeit merkte ich, dass die offenbar richtig viel Freude hatten. Sie grinsten die ganze Zeit, sie pfefferten ihre alten Hits mit großartiger Energie ins Publikum. Von »langsam« und »alt« konnte keine Frage sein; die sahen auch genauso aus wie früher (na ja, die paar Falten erkannte ich einfach nicht).
Sie spielten natürlich alle großen Hits wie »Orgasm Addict« oder »Harmony In My Head« – mein Lieblingsstück dieser Band – und natürlich der Über-Hit »Ever Fallen In Love«. Und irgendwann konnte ich nicht mehr still stehen und mit dem Fuß wippen, sondern fing an, wie ein Teenager herumzuhüpfen. Ich sprang, ich sang, ich lachte, ich freute mich.
So habe ich die Band in Erinnerung, und wenn ich die alten Stücke der Buzzcocks anhöre, denke ich an dieses Konzert. Dass Pete Shelley jetzt gestorben ist, trifft mich tatsächlich.
07 Dezember 2018
Parken bei den Flamingos
Wenn ich in den vergangenen Monaten mit der Straßenbahn zum Bahnhof fuhr, um dann – immer genügend Puffer eingeplant – mit dem Zug irgendwohin zu fahren, geriet ich eigentlich stets in Stress. Der Grund: Die Straßenbahn hielt irgendwo an und blieb stehen, ohne dass ich einen Grund dafür erkannte. Zuletzt: sieben Minuten vor dem Europaplatz, acht fünf Minuten an der Ebertstraße – um das auszugleichen, müsste ich eine Dreiviertelstunde einkalkulieren, nicht nur eine halbe.
Also fuhr ich am Freitagmorgen mit dem Rad. Es war vergleichsweise warm, ich hatte dennoch eine Mütze auf. Und ich schwitzte ordentlich, kam aber gut durch das Verkehrsgewühl und pünktlich zum Bahnhof. Alles gut geklappt.
Nur: Einen vernünftigen Abstellplatz fürs Rad fand ich noch nie, auch an diesem Tag nicht. Alle offiziellen Plätze waren völlig zugestellt, zudem standen überall »wild parkende« Räder. Ich kettete mein Fahrrad an den Zaun des Zoos, wo ich es hoffentlich wiederfinden würde.
Hinter dem Zaun stand eine Gruppe von Flamingos, gut ein Dutzend. Sie ignorierten mich, standen cool auf einem Bein oder hüpften gelangweilt herum. Mit ihrer Hilfe, so dachte ich, würde mir am Abend die Orientierung gelingen ...
Also fuhr ich am Freitagmorgen mit dem Rad. Es war vergleichsweise warm, ich hatte dennoch eine Mütze auf. Und ich schwitzte ordentlich, kam aber gut durch das Verkehrsgewühl und pünktlich zum Bahnhof. Alles gut geklappt.
Nur: Einen vernünftigen Abstellplatz fürs Rad fand ich noch nie, auch an diesem Tag nicht. Alle offiziellen Plätze waren völlig zugestellt, zudem standen überall »wild parkende« Räder. Ich kettete mein Fahrrad an den Zaun des Zoos, wo ich es hoffentlich wiederfinden würde.
Hinter dem Zaun stand eine Gruppe von Flamingos, gut ein Dutzend. Sie ignorierten mich, standen cool auf einem Bein oder hüpften gelangweilt herum. Mit ihrer Hilfe, so dachte ich, würde mir am Abend die Orientierung gelingen ...
06 Dezember 2018
Ein Inhaltsverzeichnis, getippt natürlich
Wer sich in den frühen 80er-Jahren mit Fanzines beschäftigte, hatte meist keine Höhepunkte der Layout-Kultur vor sich. Mein Heft war keine Ausnahme. Auch wenn ich mir viel Mühe gab – ich bekam keine vernünftige Gestaltung hin. Man sieht das sehr deutlich am Inhaltsverzeichnis der dritten Ausgabe von SAGITTARIUS.
Natürlich wurde diese Seite mit einer Schreibmaschine getippt, das war damals normal. Nur ganz wenige Fanzinemacher hatten Zugriff auf moderne Satzgeräte, und Hefte dieser Art wurden sofort als semiprofessionell betrachtet.
Ich saß in meinem Kinderzimmer unter dem Dach unseres kleinen Hauses, vor mit eine Kofferschreibmaschine, die nicht viel Geld gekostet hatte, und hämmerte mit allen zehn Fingern wie ein Besessener in die Tasten. Es musste zeitweise ein fürchterlicher Radau gewesen sein, lauter noch als die Musik, die aus dem Kassetten-Rekorder wummerte.
Ein echtes Problem war dabei, den Zeilenrandausgleich hinzubekommen. Das geschah durch sauberes Auszählen. Jeder Punkt wurde sauber gesetzt, und nötigenfalls wurde mit Tipp-Ex – was ganz schön teuer war – schnell ausgeglichen. Für eine Seite wie das Inhaltsverzeichnis benötigte ich also recht viel Zeit.
Schaue ich mir heute die Liste der freien Mitarbeiter an, fühlt sich das seltsam an. Mit den meisten habe ich keinen Kontakt mehr, Manfred Borchard ist leider verstorben, und von einigen weiß ich nur noch den Namen, sonst aber nichts mehr.
Nicht einmal mehr die Schreibmaschine besitze ich noch. Die verkaufte ich im Januar 1988 an einen Autohändler in Ougadougou. Aber das ist dann eine ganz andere Geschichte …
Natürlich wurde diese Seite mit einer Schreibmaschine getippt, das war damals normal. Nur ganz wenige Fanzinemacher hatten Zugriff auf moderne Satzgeräte, und Hefte dieser Art wurden sofort als semiprofessionell betrachtet.
Ich saß in meinem Kinderzimmer unter dem Dach unseres kleinen Hauses, vor mit eine Kofferschreibmaschine, die nicht viel Geld gekostet hatte, und hämmerte mit allen zehn Fingern wie ein Besessener in die Tasten. Es musste zeitweise ein fürchterlicher Radau gewesen sein, lauter noch als die Musik, die aus dem Kassetten-Rekorder wummerte.
Ein echtes Problem war dabei, den Zeilenrandausgleich hinzubekommen. Das geschah durch sauberes Auszählen. Jeder Punkt wurde sauber gesetzt, und nötigenfalls wurde mit Tipp-Ex – was ganz schön teuer war – schnell ausgeglichen. Für eine Seite wie das Inhaltsverzeichnis benötigte ich also recht viel Zeit.
Schaue ich mir heute die Liste der freien Mitarbeiter an, fühlt sich das seltsam an. Mit den meisten habe ich keinen Kontakt mehr, Manfred Borchard ist leider verstorben, und von einigen weiß ich nur noch den Namen, sonst aber nichts mehr.
Nicht einmal mehr die Schreibmaschine besitze ich noch. Die verkaufte ich im Januar 1988 an einen Autohändler in Ougadougou. Aber das ist dann eine ganz andere Geschichte …
05 Dezember 2018
Zusammengerottet
Wir standen auf dem Balkon, jeder eine Flasche »Tannenzäpfle« in der Hand. Vom dritten Stock aus hatte man einen guten Blick über die Straße und die Häuser der Umgebung.
»Gar nicht schlecht, deine neue Bude«, meinte Pleite, der mich zum ersten Mal besuchte. »So langsam wohnt ihr alle in der Südweststadt.«
Ich nickte und zeigte in verschiedene Richtungen, wer wo in welchen Häusern lebte, den ich kannte. Pleite ergänzte durch zwei, drei weitere Leute. Ich war wenige Tage zuvor in die neue Wohnung in der Hirschstraße gezogen und erhielt von vielen Freunden wertvolle Unterstützung; allein wäre ich im Chaos untergegangen.
»Ihr rottet euch jetzt also in der Südweststadt zusammen«, spottete er. »Dann fällt's den Bullen leichter, wenn sie euch mal ausräuchern wollen.«
»Wieso ausräuchern? Wir sind doch allesamt brave Bürger, die ihre Steuer zahlen.«
Er zeigte mit dem Daumen nach hinten, wo meine Jacke auf dem Sofa lag. »Disco-Punx Karlsruhe. Ein Ruf wie ein Donnerhall.« Er lachte. »Ich seh' schon die Schlagzeile vor mir. ›Polizei hebt gefährliches Netzwerk aus‹ oder so.«
Ich lachte auch. »Na ja, da werden sie nicht viel finden.«
»Sicher?« Er wies auf meine Wand mit Schallplatten. »Aus dem gesammelten Deutschpunk und den entsprechenden Texten kann die Bullerei doch gleich eine komplette Verhaftung ableiten.« Er fing an zu singen. »Polizei SA SS ...«
»Hör auf!«, rief ich und legte ihm die Hand auf den Mund. »Bist du wahnsinnig?«
Er lachte erneut. »Klare Ansage: Wenn das die Nachbarn hören ...« Er hob die Flasche an, als wollte er mit ihr der gesamten Nachbarschaft zuprosten. »So wird das auf jeden Fall nichts mit der Revolution.«
»Vor allem nicht mit Bier aus der Staatsbrauerei«, konterte ich und wies auf das Etikett.
Wir grinsten uns an, dann stießen wir die Flaschen zusammen. Punk war 1998 zu einer Angelegenheit geworden, die uns immer mehr mit den Widersprüchen unseres Lebens konfrontierte. Und eine vernünftige Antwort auf die Widersprüche hatte keiner von uns.
Da war es besser, auf einem Balkon zu stehen, Bier zu trinken und stumm auf die Stadt zu schauen ...
»Gar nicht schlecht, deine neue Bude«, meinte Pleite, der mich zum ersten Mal besuchte. »So langsam wohnt ihr alle in der Südweststadt.«
Ich nickte und zeigte in verschiedene Richtungen, wer wo in welchen Häusern lebte, den ich kannte. Pleite ergänzte durch zwei, drei weitere Leute. Ich war wenige Tage zuvor in die neue Wohnung in der Hirschstraße gezogen und erhielt von vielen Freunden wertvolle Unterstützung; allein wäre ich im Chaos untergegangen.
»Ihr rottet euch jetzt also in der Südweststadt zusammen«, spottete er. »Dann fällt's den Bullen leichter, wenn sie euch mal ausräuchern wollen.«
»Wieso ausräuchern? Wir sind doch allesamt brave Bürger, die ihre Steuer zahlen.«
Er zeigte mit dem Daumen nach hinten, wo meine Jacke auf dem Sofa lag. »Disco-Punx Karlsruhe. Ein Ruf wie ein Donnerhall.« Er lachte. »Ich seh' schon die Schlagzeile vor mir. ›Polizei hebt gefährliches Netzwerk aus‹ oder so.«
Ich lachte auch. »Na ja, da werden sie nicht viel finden.«
»Sicher?« Er wies auf meine Wand mit Schallplatten. »Aus dem gesammelten Deutschpunk und den entsprechenden Texten kann die Bullerei doch gleich eine komplette Verhaftung ableiten.« Er fing an zu singen. »Polizei SA SS ...«
»Hör auf!«, rief ich und legte ihm die Hand auf den Mund. »Bist du wahnsinnig?«
Er lachte erneut. »Klare Ansage: Wenn das die Nachbarn hören ...« Er hob die Flasche an, als wollte er mit ihr der gesamten Nachbarschaft zuprosten. »So wird das auf jeden Fall nichts mit der Revolution.«
»Vor allem nicht mit Bier aus der Staatsbrauerei«, konterte ich und wies auf das Etikett.
Wir grinsten uns an, dann stießen wir die Flaschen zusammen. Punk war 1998 zu einer Angelegenheit geworden, die uns immer mehr mit den Widersprüchen unseres Lebens konfrontierte. Und eine vernünftige Antwort auf die Widersprüche hatte keiner von uns.
Da war es besser, auf einem Balkon zu stehen, Bier zu trinken und stumm auf die Stadt zu schauen ...
04 Dezember 2018
Illegale Farben tragen Grau
Schaut man sich die – immer noch – aktuelle Platte der Band Illegale Farben an, die den Titel »Grau« trägt, könnte man meinen, ein depressives Album vor sich zu haben. Hört man sich dann aber alles an, wird es bunt, gefühlvoll und abwechslungsreich – und das meine ich an dieser Stelle absolut als Lob.
Nennt es Emo, nennt es Indie, nennt es Dance-Punk – Illegale Farben zelebrieren auf dieser Platte einen vielfältigen, ja, schon überwältigenden Stil-Mix, der mich überzeugt. Es ist die zweite Platte der Band, mit der sie sich stärker vom großen Vorbild befreien kann und nicht mehr so stark nach den frühen Fehlfarben-Aufnahmen klingt. Veröffentlicht wurde sie Ende 2017.
Da lodert die Gitarre mal über längere Zeit richtiggehend hell wie im Stück »Sirenen«, da wummert der Bass in psychotisch-paranoider Weise in dem starken Lied »Willkommen im Tunnel«, da wird das Stück »Kein Problem« in seiner Monotonie und maschinenhaften Starre zu etwas, das ich nur als unfassbar cool bezeichnen kann.
Was die Band macht, ist Neue Deutsche Welle im positiven Sinn. Das klingt nicht wie 1979 bis 1981, natürlich klingt es auch nicht wie die Bands, die danach das Genre totritten – aber die Vergleiche bieten sich einfach an. Hier ist eine Band, die versucht, neue Wege zu gehen, die sich nicht trotzig vom Punk abwendet, sondern ihn auf ihre Weise verändert und für sich anpasst.
Da zapple ich automatisch mit, ob ich die Platte daheim anhöre oder mir die Band live angucke. Immer wieder bin ich von den guten Texten verblüfft, die nicht pathetisch sind, die keine konkrete Politik verkünden, aber immer wieder Lebensfragen klar in den Raum stellen.
Ach – ich kann das eh nicht richtig formulieren: Die Platte ist super. Anhören bitte!
Nennt es Emo, nennt es Indie, nennt es Dance-Punk – Illegale Farben zelebrieren auf dieser Platte einen vielfältigen, ja, schon überwältigenden Stil-Mix, der mich überzeugt. Es ist die zweite Platte der Band, mit der sie sich stärker vom großen Vorbild befreien kann und nicht mehr so stark nach den frühen Fehlfarben-Aufnahmen klingt. Veröffentlicht wurde sie Ende 2017.
Da lodert die Gitarre mal über längere Zeit richtiggehend hell wie im Stück »Sirenen«, da wummert der Bass in psychotisch-paranoider Weise in dem starken Lied »Willkommen im Tunnel«, da wird das Stück »Kein Problem« in seiner Monotonie und maschinenhaften Starre zu etwas, das ich nur als unfassbar cool bezeichnen kann.
Was die Band macht, ist Neue Deutsche Welle im positiven Sinn. Das klingt nicht wie 1979 bis 1981, natürlich klingt es auch nicht wie die Bands, die danach das Genre totritten – aber die Vergleiche bieten sich einfach an. Hier ist eine Band, die versucht, neue Wege zu gehen, die sich nicht trotzig vom Punk abwendet, sondern ihn auf ihre Weise verändert und für sich anpasst.
Da zapple ich automatisch mit, ob ich die Platte daheim anhöre oder mir die Band live angucke. Immer wieder bin ich von den guten Texten verblüfft, die nicht pathetisch sind, die keine konkrete Politik verkünden, aber immer wieder Lebensfragen klar in den Raum stellen.
Ach – ich kann das eh nicht richtig formulieren: Die Platte ist super. Anhören bitte!
Eine kleine Verwirrung im Literaturhaus
Das Literaturhaus in Frankfurt ist ein beeindruckendes Gebäude: einladend und schön, klassisch von außen, modern im Innern. Ich besuche es gern. Halte ich mich in diesem Gebäude auf, fühle ich mich automatisch ein wenig wichtiger und größer.
Will man auf eine Toilette gehen, nimmt man die breite Treppe nach unten. Danach steht man vor Türen, die zu den Toiletten für Damen – links – und Herren führen.
Dort stand ich auch. Ich starrte auf das »Leser«-Schild, fühlte mich sehr angesprochen und öffnete die Tür. Alles war korrekt, fand ich. Den weiteren Vorgang muss ich an dieser Stelle wohl nicht beschreiben, das können sich die meisten selbst denken.
Aber was machen Leute, die nur Hörbücher hören und nicht lesen? Dürfen Autoren auch aufs Klo oder haben die eine eigene Tür? Fragen über Fragen …
Will man auf eine Toilette gehen, nimmt man die breite Treppe nach unten. Danach steht man vor Türen, die zu den Toiletten für Damen – links – und Herren führen.
Dort stand ich auch. Ich starrte auf das »Leser«-Schild, fühlte mich sehr angesprochen und öffnete die Tür. Alles war korrekt, fand ich. Den weiteren Vorgang muss ich an dieser Stelle wohl nicht beschreiben, das können sich die meisten selbst denken.
Aber was machen Leute, die nur Hörbücher hören und nicht lesen? Dürfen Autoren auch aufs Klo oder haben die eine eigene Tür? Fragen über Fragen …
03 Dezember 2018
Spaziergang in Noyers
Es war spät, als wir noch durch Noyers bummelten. Die laue Sommerluft hatte die Hitze des Tages verdrängt, es herrschte ein sehr angenehmes Klima vor. Auf dem Kopfsteinpflaster und zwischen den alten Gebäuden hallten unsere Schritte wieder, aber wir achteten nicht darauf.
Ich staunte über die Gemeinde, die zwar nur einige hundert Einwohner hatte, aber auf mich wie eine kleine Stadt wirkte. Arkaden an den Gebäuden um den alten Marktplatz, einige Kneipen und Pensionen – in den vergangenen Jahren waren Touristen wie wir auf die Gemeinde aufmerksam geworden. Noyers-sur-Serein zählte zu den »schönsten Dörfern Frankreich«, ein Titel, den ich an diesem Ort für absolut angebracht hielt.
Seit dem Mittelalter wurden die Häuser bewohnt, sie wirkten teilweise schief, strahlten in meinen Augen aber eine uralte Würde aus, eine Gelassenheit und Ruhe. Vor allem in der Nacht wirkten sie eindrucksvoll, nur wenige Menschen waren unterwegs, und niemand störte die Ruhe. Schnitzereien an den alten Balken, vorstehende Erker und wuchtiges Gemäuer ließen mich immer wieder anhalten und einige Details betrachten.
Am stärksten beeindruckten mich die kleinen Kunstwerke an der Papierwarenhandlung, die in der Nacht aussahen, als seien sie Lebewesen. Allerlei Gestalten aus Papier klammerten sich an Holz und saßen auf Steinen, ein bizarrer Anblick, der mich an alte Filme erinnerte. Das war Fantasy in der Realität, auf einen Schlag fühlte ich mich wie herausgerissen aus unserer Welt.
Ein schöner Abschluss eines gelungenen Tages in Burgund! Die kleinen Papiermenschen aus Noyers würde ich wohl nicht so schnell vergessen …
Ich staunte über die Gemeinde, die zwar nur einige hundert Einwohner hatte, aber auf mich wie eine kleine Stadt wirkte. Arkaden an den Gebäuden um den alten Marktplatz, einige Kneipen und Pensionen – in den vergangenen Jahren waren Touristen wie wir auf die Gemeinde aufmerksam geworden. Noyers-sur-Serein zählte zu den »schönsten Dörfern Frankreich«, ein Titel, den ich an diesem Ort für absolut angebracht hielt.
Seit dem Mittelalter wurden die Häuser bewohnt, sie wirkten teilweise schief, strahlten in meinen Augen aber eine uralte Würde aus, eine Gelassenheit und Ruhe. Vor allem in der Nacht wirkten sie eindrucksvoll, nur wenige Menschen waren unterwegs, und niemand störte die Ruhe. Schnitzereien an den alten Balken, vorstehende Erker und wuchtiges Gemäuer ließen mich immer wieder anhalten und einige Details betrachten.
Am stärksten beeindruckten mich die kleinen Kunstwerke an der Papierwarenhandlung, die in der Nacht aussahen, als seien sie Lebewesen. Allerlei Gestalten aus Papier klammerten sich an Holz und saßen auf Steinen, ein bizarrer Anblick, der mich an alte Filme erinnerte. Das war Fantasy in der Realität, auf einen Schlag fühlte ich mich wie herausgerissen aus unserer Welt.
Ein schöner Abschluss eines gelungenen Tages in Burgund! Die kleinen Papiermenschen aus Noyers würde ich wohl nicht so schnell vergessen …
02 Dezember 2018
Zehn Jahre und eine Lesung
Im Vorfeld war ich ein wenig angespannt: Ich sollte auf einer Party lesen, bei der hinterher zwei Punkrock-Bands aufspielen sollten. Würde das gut gehen? Würde es ein Publikum für die Lesung geben? Würden sich nicht alle darauf freuen, zu lauter Musik ebenso laut zu feiern?
So radelte ich am Samstag, 1. Dezember 2018, bei eher feuchtkühlem Wetter in die Nordstadt von Karlsruhe. Als ich im P 8 eintraf, waren dort anfangs nur wenige Leute anwesend. Ich trank zwei Bier, um meine Nervosität loszuwerden, unterhielt mich mit den Veranstaltern und kletterte irgendwann auf die Bühne.
Weil ich die falsche Brille dabei hatte, tat ich mich recht lange schwer mit dem Buch: Mit Brille war's nichts, ohne Brille auch nichts. Ernsthaft: Solche Probleme hätte ich mir vor zwanzig Jahren nicht einmal vorstellen können. Aber ich konnte sehen, dass sich gut drei Dutzend Leute im Raum aufhielten und sitzend oder an der Theke stehend meiner Lesung folgten.
Vor allem las ich aus dem aktuellen Punkrock-Buch vor, also aus »Für immer Punk?«, dazwischen erzählte ich allerlei Geschichten. Später gab's auch eine kurze Sequenz aus »Zwei Whisky mit Neumann« und den Text »Maschinengewehr, sing!«, den ich nach all den Jahren selbst immer noch gut finde.
Danach ließ ich mich gern in ein Gespräch verwickeln, trank Bier, verkaufte Bücher und räumte meinen Kram weg. Parallel dazu wurde der seriöse Teil der Veranstaltung vorbereitet.
Weil das Thema des Abends der zehnte Geburtstag der Libertären Gruppe Karlsruhe war, gab es einen Rückblick mit einer Rede, mit Bildern und einem kleinen Filmbeitrag. In Zeiten wie diesen finde ich es wichtig, dass es Leute gibt, die sich für ihre Überzeugung – und Anarchismus finde ich immer noch erstrebenswert – auf die Straße stellen und sich dafür einsetzen.
Später stand ich im Freien. Ein Lagerfeuer brannte, ich trank Bier und unterhielt mich. Als dann die Band Arschwasser spielte, ging ich in den Veranstaltungsraum hinein. Die Band, bestehend aus zwei Frauen und einem Mann, prügelte sich durch 35 Jahre Punkrock und Hardcore, mit durchaus eigenwilligen Versionen alter Punkrock-Hits. Das gefiel mir, einige Leute hüpften herum.
Mir reichte es dann doch irgendwann. Ich hatte einige Biere zu viel getrunken und fühlte mich vom Lagerfeuer völlig geräuchert. Also schnappte ich meinen Kram und radelte heim – das Ende eines gelungenen Abends.
So radelte ich am Samstag, 1. Dezember 2018, bei eher feuchtkühlem Wetter in die Nordstadt von Karlsruhe. Als ich im P 8 eintraf, waren dort anfangs nur wenige Leute anwesend. Ich trank zwei Bier, um meine Nervosität loszuwerden, unterhielt mich mit den Veranstaltern und kletterte irgendwann auf die Bühne.
Weil ich die falsche Brille dabei hatte, tat ich mich recht lange schwer mit dem Buch: Mit Brille war's nichts, ohne Brille auch nichts. Ernsthaft: Solche Probleme hätte ich mir vor zwanzig Jahren nicht einmal vorstellen können. Aber ich konnte sehen, dass sich gut drei Dutzend Leute im Raum aufhielten und sitzend oder an der Theke stehend meiner Lesung folgten.
Vor allem las ich aus dem aktuellen Punkrock-Buch vor, also aus »Für immer Punk?«, dazwischen erzählte ich allerlei Geschichten. Später gab's auch eine kurze Sequenz aus »Zwei Whisky mit Neumann« und den Text »Maschinengewehr, sing!«, den ich nach all den Jahren selbst immer noch gut finde.
Danach ließ ich mich gern in ein Gespräch verwickeln, trank Bier, verkaufte Bücher und räumte meinen Kram weg. Parallel dazu wurde der seriöse Teil der Veranstaltung vorbereitet.
Weil das Thema des Abends der zehnte Geburtstag der Libertären Gruppe Karlsruhe war, gab es einen Rückblick mit einer Rede, mit Bildern und einem kleinen Filmbeitrag. In Zeiten wie diesen finde ich es wichtig, dass es Leute gibt, die sich für ihre Überzeugung – und Anarchismus finde ich immer noch erstrebenswert – auf die Straße stellen und sich dafür einsetzen.
Später stand ich im Freien. Ein Lagerfeuer brannte, ich trank Bier und unterhielt mich. Als dann die Band Arschwasser spielte, ging ich in den Veranstaltungsraum hinein. Die Band, bestehend aus zwei Frauen und einem Mann, prügelte sich durch 35 Jahre Punkrock und Hardcore, mit durchaus eigenwilligen Versionen alter Punkrock-Hits. Das gefiel mir, einige Leute hüpften herum.
Mir reichte es dann doch irgendwann. Ich hatte einige Biere zu viel getrunken und fühlte mich vom Lagerfeuer völlig geräuchert. Also schnappte ich meinen Kram und radelte heim – das Ende eines gelungenen Abends.
Abonnieren
Posts (Atom)