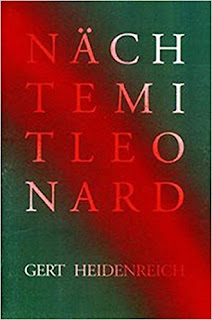Zu den Romanen der phantastischen Literatur, die man gelesen haben sollte, zählt für mich schon seit vielen Jahren »Meister und Margarita« des russischen Schriftstellers Michail Bulgakow. Ich kannte bislang nur die Ausgabe, die in den frühen 80er-Jahren in der DDR erschienen war; jetzt las ich mit großer Spannung und wachsender Begeisterung die Neuübersetzung des Werks, die im Verlag Galiani Berlin veröffentlicht worden ist.
Galiani hat den Roman auf »neue Beine« stellen lassen. Kein Wunder – der Verlag musste keine ideologische Rücksicht auf die Sowjetunion nehmen, die der Autor zwischen den Zeilen immer wieder kritisierte und satirisch hinterfragte.
Ein umfangreicher Fußnoten-Apparat erklärt im Anhang viele Details, die dem heutigen Leser nicht auffallen können; dazu kommt ein spannendes Nachwort. Der Roman wird damit in seine Zeit eingeordnet, und es wird klar, warum er – erstens – als Meisterwerk gilt und es – zweitens – so schwierig ist, eine »Endversion« anzufertigen.
Tatsächlich ist der Hintergrund des Werkes fast spannender als sein eigentlicher Inhalt. Der Autor schrieb an seinem Roman während der stalinistischen Ära. Zwischen 1928 und 1940 arbeitete er immer wieder daran, während er Kurzgeschichten veröffentlichte und für Zeitungen tätig war. Veröffentlicht wurde der Roman erst 1966, nach dem Tod seines Autors also, und damals auch in einer zensierten Version. Diese zensierte Version wurde rasch in den Westen übersetzt und faszinierte viele Menschen; laut Wikipedia schrieb Mick Jagger nach der Lektüre den Rolling-Stones-Song »Sympathy For The Devil«.
Warum ein phantastischer Roman einen so großen Einfluss haben konnte? Weil man so viel hineininterpretieren kann.
Ein Magier und ein sprechender Kater kommen nach Moskau und verwirren dort die Gesellschaft. Andere Kapitel zeigen das Jerusalem zur Zeit Christi, sie stellen die Herrschaft des Pontius Pilatus der Menschenliebe des Jesus Christus gegenüber. Jede Szene in diesem kunterbunten, extrem unterhaltsamen und immer wieder mit wunderbaren Szenen begeisternden Buch kann als Anspielung auf politische Ereignisse gelesen werden.
Die Version, die bei Galiani erschienen ist, versucht immerhin, einen Originaltext wiederherzustellen – das war wegen der Entstehungsgeschichte und der vielen Versionen des Werkes nicht einfach. Es entstand ein Buch, das sehr hochwertig ausgestattet ist: ein schicker Halbleinenband mit 608 Seiten Umfang, mit Lesebändchen, mit zahlreichen Illustrationen, einem lesenswerten Nachwort und den umfangreichen Anmerkungen. In diesem Fall lohnt es sich, die Hardcover-Version zu haben.
Selbstverständlich ist »Meister und Margarita« kein Fantasy-Roman, es ist vor allem eine satirisch verbrämte Darstellung der stalinistischen Zeit. Immer wieder finden sich Hinweise auf eine Zeit des Terrors und gleichzeitig der großen sozialen Not. Der Autor schaffte es aber, durch seine phantastische Handlung, in der Zauberei und Magie, Träume und Diskussionen gleichermaßen existieren, einen Roman zu schaffen, den ich für ein Meisterwerk der Phantastik halte.
(Übrigens ist der Wikipedia-Artikel zu diesem Roman sehr lesenswert. Ausführlich informiert er nicht nur über den Inhalt und die wichtigsten Figuren, sondern stellt auch die Entstehungsgeschichte dar und liefert Bezüge zu Goethes »Faust«. Lesenswert ist sowieso die Leseprobe auf der Internet-Seite des Verlages.)
Es passiert einiges um mich herum, und nicht alles gefällt mir. Vieles fasziniert mich, vieles interessiert mich – und das soll Thema dieses Blogs sein.
30 Dezember 2019
27 Dezember 2019
Ghoul-Parasiten und andere Höllenmächte
Auf einen Titel wie »Ghoul-Parasiten« muss man erst einmal kommen ... 1983 erschien der Heftroman mit dem gleichnamigen Titel. Das Hörspiel auf Basis dieses Romans wurde 2015 veröffentlicht, mit einem unglaublichen Titelbild, das ebenso auf einem »schundigen« Science-Fiction-Roman hätte erscheinen können. Ich hörte es an, und ich amüsierte mich sehr dabei.
Tatsächlich ist das Hörspiel ein wüster Genre-Mix. Gestaltwandler treten auf, Dimensionstore spielen eine Rolle, man landet in einem fremden Universum – so weit kann man das als Science Fiction betrachten. Magie aller Art wird eingesetzt, sogar weiße Magie spielt eine Rolle – wer mag, kann das zur Fantasy rechnen.
Aber natürlich stammen menschenfressende Monster, die mit goldenen Revolvern schießen, eher aus dem Gruselroman, und dabei handelt es sich hier: Ich hörte mal wieder ein »John Sinclair«-Hörspiel, in dem es von überraschenden Wendungen, bizarren Beziehungen und knalligen Dialogen nur so wimmelt. Ganz nebenbei spielen nämlich noch ein Mafioso und seine Drogengeschäfte eine Rolle – der Genre-Mix wird also durch eine tüchtige Krimi-Prise abgeschmeckt.
Wie immer: Ernst nehmen kann man das zwar nicht, ich mag aber den »trashigen« Charakter dieser Hörspiele. Dennis Ehrhardt hat aus der alten Vorlage eine spannende Geschichte gemacht, Lübbe-Audio lieferte wieder einmal ein richtig gutes Hörspiel ab. Die Geräusche sind hervorragend, die Dialoge wirken nachvollziehbar, und der Handlungsverlauf ist knallig – ich muss mich dabei nicht gruseln, fühle mich aber gut unterhalten.
So ist der gute alte Gruselroman doch für eine Audio-Überraschung gut. Das mag ich!
Tatsächlich ist das Hörspiel ein wüster Genre-Mix. Gestaltwandler treten auf, Dimensionstore spielen eine Rolle, man landet in einem fremden Universum – so weit kann man das als Science Fiction betrachten. Magie aller Art wird eingesetzt, sogar weiße Magie spielt eine Rolle – wer mag, kann das zur Fantasy rechnen.
Aber natürlich stammen menschenfressende Monster, die mit goldenen Revolvern schießen, eher aus dem Gruselroman, und dabei handelt es sich hier: Ich hörte mal wieder ein »John Sinclair«-Hörspiel, in dem es von überraschenden Wendungen, bizarren Beziehungen und knalligen Dialogen nur so wimmelt. Ganz nebenbei spielen nämlich noch ein Mafioso und seine Drogengeschäfte eine Rolle – der Genre-Mix wird also durch eine tüchtige Krimi-Prise abgeschmeckt.
Wie immer: Ernst nehmen kann man das zwar nicht, ich mag aber den »trashigen« Charakter dieser Hörspiele. Dennis Ehrhardt hat aus der alten Vorlage eine spannende Geschichte gemacht, Lübbe-Audio lieferte wieder einmal ein richtig gutes Hörspiel ab. Die Geräusche sind hervorragend, die Dialoge wirken nachvollziehbar, und der Handlungsverlauf ist knallig – ich muss mich dabei nicht gruseln, fühle mich aber gut unterhalten.
So ist der gute alte Gruselroman doch für eine Audio-Überraschung gut. Das mag ich!
Guitar Gangsters zum zehnten Mal
Als sich die Guitar Gangsters vor dreißig Jahren gründeten, waren Oi! und Streetpunk eigentlich kein Thema mehr, vor allem in England. Doch die Band setzte damals mit schmissigem Sound und guten Melodien ihre Akzente. Und sie ist immer noch da, was mich tatsächlich verblüfft hat.
Im Herbst 2017 kam mit »Sex & Money« der zehnte Tonträger heraus, den ich mittlerweile auch angehört habe. Zwölf Stücke sind darauf, darunter eine Coverversion (»The Sound Of Silence« von Simon & Garfunkel; ob das wirklich hat sein müssen?). Und wenn ich fair sein soll: Einige Stücke sind großartig, einige sind schlapp – aber das muss wohl so sein.
Vor allem am Anfang begeistert mich die Platte. Stücke wie »Obsession« sind großartig, das ist schmissiger Punkrock der ganz alten Schule, der viele Melodien liefert und zum Mitgrölen anregt. Auch ein bierselig-knackiges Lied wie »Shut Up (And Get Me A Drink)« gefällt mir.
Manchmal eiert die Band leider auch. Stücke wie »Durnsford Wrecks« sind ziemlich schlapp und langweilen durch langsame Melodien und zu viel Gitarrengefiedel. Und sogar ein balladeskes Liebeslied hat die Band auf die Platte gepackt; das hätten sich die Guitar Gangsters sparen können.
Insgesamt aber eine gelungene Platte mit einigen leichten Schatten – wer auf klassischen Streetpunk steht, dürfte die Band dennoch mögen. (Veröffentlicht bei Wanda Records.)
Im Herbst 2017 kam mit »Sex & Money« der zehnte Tonträger heraus, den ich mittlerweile auch angehört habe. Zwölf Stücke sind darauf, darunter eine Coverversion (»The Sound Of Silence« von Simon & Garfunkel; ob das wirklich hat sein müssen?). Und wenn ich fair sein soll: Einige Stücke sind großartig, einige sind schlapp – aber das muss wohl so sein.
Vor allem am Anfang begeistert mich die Platte. Stücke wie »Obsession« sind großartig, das ist schmissiger Punkrock der ganz alten Schule, der viele Melodien liefert und zum Mitgrölen anregt. Auch ein bierselig-knackiges Lied wie »Shut Up (And Get Me A Drink)« gefällt mir.
Manchmal eiert die Band leider auch. Stücke wie »Durnsford Wrecks« sind ziemlich schlapp und langweilen durch langsame Melodien und zu viel Gitarrengefiedel. Und sogar ein balladeskes Liebeslied hat die Band auf die Platte gepackt; das hätten sich die Guitar Gangsters sparen können.
Insgesamt aber eine gelungene Platte mit einigen leichten Schatten – wer auf klassischen Streetpunk steht, dürfte die Band dennoch mögen. (Veröffentlicht bei Wanda Records.)
23 Dezember 2019
BWA vor Weihnachten
 Man muss es klar sagen: Die große Zeit der auf Papier gedruckten Fanzines ist schon lange vorüber.
Man muss es klar sagen: Die große Zeit der auf Papier gedruckten Fanzines ist schon lange vorüber. Deshalb freue ich mich umso mehr, wenn ich eines in den Fingern halten und lesen kann. Die Auflagenzahlen sind ja leider auch nicht mehr mit den 80er-Jahren vergleichbar.
Zuletzt las ich die aktuelle Ausgabe von »Baden-Württemberg Aktuell«, locker mit »BWA« abgekürzt. Wem der Begriff »BWA« nichts sagt, muss sich
nicht grämen. Die Abkürzung steht für »Baden Württemberg Aktuell«, was
aber weder für die Politik noch die Wirtschaft des Bundeslandes steht,
in dem ich seit meiner Geburt lebe. Es handelt
sich um das Fanzine des Science Fiction Clubs Baden-Württemberg, in dem
ich viele Jahre auch Mitglied war, dessen Heft ich aber immer wieder
gern durchschmökere.
Die Ausgabe 435 hat ein nettes Weihnachtstitelbild und glänzt vor allem durch einige Leserbriefe. Ich las sicher nicht alles in diesem Heft, aber die Leserbriefe führte ich mir allesamt zu Gemüte. Martin Baresch, bekannter Science-Fiction- und Fantasy-Übersetzer und Autor in allen möglichen Bereichen, war in früheren Jahren sehr aktiv im Verein; damals äußerte er sich gern als »Doc Höhn«. An solche Glanzzeiten erinnert sein Brief in dieser Ausgabe.
Das Fanzine wird von Uwe Lammers herausgegeben, der zwar nicht in Baden-Württemberg wohnt, sich aber seit langem für den Verein engagiert. Auf seine Antwort in der nächsten »BWA«-Ausgabe bin ich gespannt. In Zeiten der schnellen Internet-Kommunikation und der flotten Streitereien via Twitter und Facebook fände ich ein altmodisches Duell mit Leserbriefen ja geradezu entspannend.
Ein schöner Jahresausblick für einen ollen Fanzine-Freund wie mich!
21 Dezember 2019
Alles vor Weihnachten
Wir dachten, es würde ein Alptraum, wenn wir versuchten, schlau zu sein. »Es wird anstrengend, aber wir behalten die Ruhe«, redete ich mir mehrfach ein; dann fuhren wir an diesem Samstag, 21. Dezember, tatsächlich los. Grundnahrungsmittel sollten ins Haus, damit wir nicht am Montag, 23. Dezember, noch einmal in die Läden müssten.
Es geschah, womit ich nicht gerechnet hatte. Karlsruhe schien am späten Vormittag wie leergefegt zu sein. An dem Ampeln mussten wir nicht lange warten, in den Läden herrschte kein Chaos. Die meisten Leute verhielten sich auch vernünftig.
Ich war verblüfft und fasziniert. Weil ich so erfreut war, kaufte ich mir noch ein schönes Weihnachtsbier und nicht nur Zeugs zum Essen. Man muss sich ja selbst belohnen, wenn es sonst niemand tut ...
Auch recht!
Es geschah, womit ich nicht gerechnet hatte. Karlsruhe schien am späten Vormittag wie leergefegt zu sein. An dem Ampeln mussten wir nicht lange warten, in den Läden herrschte kein Chaos. Die meisten Leute verhielten sich auch vernünftig.
Ich war verblüfft und fasziniert. Weil ich so erfreut war, kaufte ich mir noch ein schönes Weihnachtsbier und nicht nur Zeugs zum Essen. Man muss sich ja selbst belohnen, wenn es sonst niemand tut ...
Auch recht!
20 Dezember 2019
Ein Club für Cola-Fans
Aus der Serie »Dinge, die die Welt nicht braucht – oder vielleicht doch?« kommt diese Information: In den Vereinigten Staaten wurde jetzt der »Coca-Cola Insiders Club« ins Leben gerufen. Im Prinzip handelt es sich um ein Abonnement: Wer mag, kann monatlich eine Sendung mit Getränken erhalten, die allesamt neu sein sollen.
Dafür muss natürlich ein Abo-Gebühr bezahlt werden; nach bisherigen Informationen sind das zehn Dollar für drei »innovative« Getränke. Anders gesagt: Pro Getränk zahlt man über drei Dollar. Angeblich sind allein fürs kommende Jahre sage und schreibe zwanzig Getränke geplant, unter anderem wird von »Coke Energy« gesprochen.
Was ich dabei wirklich spannend finde: Der Ansturm auf das neue Angebot war so groß, dass die eigentlich limitierte Aktion ruckzuck ausverkauft war. Aber gut: Die Menschen lassen sich alles ins Haus liefern. Warum also nicht auch eine Brause?
Darüber kann man sich theatralisch aufregen, oder man nimmt es mit einem interessierten Lächeln zur Kenntnis. Das zumindest versuche ich bei einem solchen Phänomen …
Dafür muss natürlich ein Abo-Gebühr bezahlt werden; nach bisherigen Informationen sind das zehn Dollar für drei »innovative« Getränke. Anders gesagt: Pro Getränk zahlt man über drei Dollar. Angeblich sind allein fürs kommende Jahre sage und schreibe zwanzig Getränke geplant, unter anderem wird von »Coke Energy« gesprochen.
Was ich dabei wirklich spannend finde: Der Ansturm auf das neue Angebot war so groß, dass die eigentlich limitierte Aktion ruckzuck ausverkauft war. Aber gut: Die Menschen lassen sich alles ins Haus liefern. Warum also nicht auch eine Brause?
Darüber kann man sich theatralisch aufregen, oder man nimmt es mit einem interessierten Lächeln zur Kenntnis. Das zumindest versuche ich bei einem solchen Phänomen …
18 Dezember 2019
Crowdfunding für das SF-Jahr
Den Hirnkost-Verlag schätze ich seit vielen Jahren, nicht nur deshalb, weil er meinen Punkrock-Büchern eine verlegerische Heimat gibt, schicke Kalender veröffentlicht und in diesem Jahr sogar »Totengräbers Tagebuch« in den Buchhandel geschoben hat. Bei Hirnkost entsteht eine sehr interessante Mixtur aus Literatur und Sachbuch, die sich sehen lassen kann. Ich schaffe es leider nicht, alles zu lesen, was der Verlag veröffentlicht.
Ganz neu ins Programm des Verlages kommt – so hoffe ich – ein dicker Wälzer, der den schlichten Titel »Das Science Fiction Jahr« tragen wird. Erstmals wurde eine Publikation unter diesem Titel im Jahr 1986 veröffentlicht, damals im Heyne-Verlag. Unter der Ägide des unvergessenen Wolfgang Jeschke wurde das Buch zu einer zentralen Institution der deutschsprachigen Science Fiction, nicht immer durch die Bank lesbar und lesenswert, aber immer wieder mit beeindruckenden Texten.
Zuletzt wurde das Buch im Golkonda-Verlag veröffentlicht – dieser kann die aktuelle Ausgabe nicht mehr stemmen. Nun springt der Hirnkost-Verlag ein, kann aber auch nicht »einfach mal so« die Produktions- und Autorenkosten stemmen.
»Um die Zukunft des traditionsreichen Buchprojekts zu sichern, brauchen wir jedoch Unterstützung«, schreiben die Herausgeber'innen. Deshalb wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, für die noch Mitstreiter'innen gesucht werden. Es gibt ein hübsches Video, das ein wenig mehr informiert, und es gibt vor allem eine Seite bei Startnext, die weiter über das Thema informiert und zum Geldsammeln angelegt worden ist.
Alle weiteren Informationen stehen eh da. Ich finde das Projekt gut, und ich denke, man sollte das auch forcieren. Aber entscheidet einfach selbst!
Ganz neu ins Programm des Verlages kommt – so hoffe ich – ein dicker Wälzer, der den schlichten Titel »Das Science Fiction Jahr« tragen wird. Erstmals wurde eine Publikation unter diesem Titel im Jahr 1986 veröffentlicht, damals im Heyne-Verlag. Unter der Ägide des unvergessenen Wolfgang Jeschke wurde das Buch zu einer zentralen Institution der deutschsprachigen Science Fiction, nicht immer durch die Bank lesbar und lesenswert, aber immer wieder mit beeindruckenden Texten.
Zuletzt wurde das Buch im Golkonda-Verlag veröffentlicht – dieser kann die aktuelle Ausgabe nicht mehr stemmen. Nun springt der Hirnkost-Verlag ein, kann aber auch nicht »einfach mal so« die Produktions- und Autorenkosten stemmen.
»Um die Zukunft des traditionsreichen Buchprojekts zu sichern, brauchen wir jedoch Unterstützung«, schreiben die Herausgeber'innen. Deshalb wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, für die noch Mitstreiter'innen gesucht werden. Es gibt ein hübsches Video, das ein wenig mehr informiert, und es gibt vor allem eine Seite bei Startnext, die weiter über das Thema informiert und zum Geldsammeln angelegt worden ist.
Alle weiteren Informationen stehen eh da. Ich finde das Projekt gut, und ich denke, man sollte das auch forcieren. Aber entscheidet einfach selbst!
17 Dezember 2019
Abschluss des ironischen Western-Comics
Ich habe den Abschlussband der famosen Western-Tetralogie »Der Mann, der keine Feuerwaffen mochte« gelesen. Wenn das kein Grund ist, noch einmal auf das Werk hinzuweisen! Verantwortlich dafür ist Wilfrid Lupano, der in den vergangenen zwei, drei Jahren hierzulande richtig bekannt geworden ist – vor allem dank seiner Serie »Die alten Knacker«, die haarsträubenden Humor mit durchaus ernsthaft-politischen Inhalten verbunden hat.
Ähnliches gilt für den Western-Vierteiler, um den es hier geht und der im Splitter-Verlag veröffentlicht worden ist. Die Handlung spielt Ende des 19. Jahrhunderts, zu einer Zeit also, in der die Indianerkriege bereits vorüber waren und die weißen Eroberer die Territorien endgültig unter sich aufteilten.
Anfangs sind auch die Wildwest-Regionen des Bundestaates Arizona der hauptsächliche Schauplatz der Geschichte, der letzte Band aber spielt in erster Linie in Washington. In der Hauptstadt der aufstrebenden USA wird das Spiel um Macht nämlich zu seiner Vollendung geführt.
In den vier Bänden spielen ein aristokratischer Engländer und mexikanische Banditen, eine coole junge Frau und indianische Kinder, haufenweise Intrigen und viel Geballer wesentliche Rollen. Humor und Entsetzen wechseln sich für den Leser durchaus ab; man kann zwischendurch breit grinsen, ist dann aber wieder von der spannenden Handlung gefesselt.
Ganz klar: »Der Mann, der keine Feuerwaffen mochte« ist kein beinharter Western, sondern einer, der die Konventionen des Genres kennt und sie in einzelnen Bereichen aufbricht. Das geschieht nicht nur erzählerisch, sondern auch von den Zeichnungen her. Paul Salomone schafft die Balance zwischen Humor und ernsthafter Grafik; er ist ebenso weit entfernt von einem »Lucky Luke«-Westernspaß wie von einem »Durango«-Realismus.
Die Serie hat überraschende Momente und macht Spaß. Wer Western-Comics mag, sollte sich auf jeden Fall die Leseproben auf der Internet-Seite des Splitter-Verlages anschauen, vielleicht zuerst die vom ersten und dann die vom vierten Band. Und wer die politischen Comics von Lupano gern gelesen hat, sollte bei diesem Comic auf jeden Fall einen Blick wagen – denn um politische Inhalte geht es auch hier ...
Ähnliches gilt für den Western-Vierteiler, um den es hier geht und der im Splitter-Verlag veröffentlicht worden ist. Die Handlung spielt Ende des 19. Jahrhunderts, zu einer Zeit also, in der die Indianerkriege bereits vorüber waren und die weißen Eroberer die Territorien endgültig unter sich aufteilten.
Anfangs sind auch die Wildwest-Regionen des Bundestaates Arizona der hauptsächliche Schauplatz der Geschichte, der letzte Band aber spielt in erster Linie in Washington. In der Hauptstadt der aufstrebenden USA wird das Spiel um Macht nämlich zu seiner Vollendung geführt.
In den vier Bänden spielen ein aristokratischer Engländer und mexikanische Banditen, eine coole junge Frau und indianische Kinder, haufenweise Intrigen und viel Geballer wesentliche Rollen. Humor und Entsetzen wechseln sich für den Leser durchaus ab; man kann zwischendurch breit grinsen, ist dann aber wieder von der spannenden Handlung gefesselt.
Ganz klar: »Der Mann, der keine Feuerwaffen mochte« ist kein beinharter Western, sondern einer, der die Konventionen des Genres kennt und sie in einzelnen Bereichen aufbricht. Das geschieht nicht nur erzählerisch, sondern auch von den Zeichnungen her. Paul Salomone schafft die Balance zwischen Humor und ernsthafter Grafik; er ist ebenso weit entfernt von einem »Lucky Luke«-Westernspaß wie von einem »Durango«-Realismus.
Die Serie hat überraschende Momente und macht Spaß. Wer Western-Comics mag, sollte sich auf jeden Fall die Leseproben auf der Internet-Seite des Splitter-Verlages anschauen, vielleicht zuerst die vom ersten und dann die vom vierten Band. Und wer die politischen Comics von Lupano gern gelesen hat, sollte bei diesem Comic auf jeden Fall einen Blick wagen – denn um politische Inhalte geht es auch hier ...
Militärisches zwischen den Welten
Was Andreas Suchanek in den vergangenen Jahren geschaffen hat, kann sich absolut sehen lassen: Vom jungen Autor, der seine eigenen Romane im Eigenverlag veröffentlichte, wurde er zu einem Verleger, der auch anderen Autorinnen und Autoren eine Chance gab. Und seine eigene Serie –»Heliosphere 2265« – wurde von ihm erfolgreich in andere Sprachen und Medien übertragen.
Unter anderem ins Hörspiel ... ich hörte dieser Tage endlich die CD »Zwischen den Welten«, den zweiten Teil der Hörspielserie. Weil ich seit der ersten CD eine so lange Pause eingelegt hatte, brauchte ich einige Zeit, bis ich wieder in die Handlung reinkam.
Viele Namen, die ich erst einsortieren musste, machten den Einstieg für mich durchaus schwierig. Wer sich für die Serie interessiert und mal reinhören möchte, sollte also auf jeden Fall mit dem ersten Hörspiel anfangen.
Die Handlung spielt auf dem Mars sowie in den Tiefen des Alls – das ist auch die Handlung, die ich spannender fand. Menschen von der Erde kommunizieren mit einem außerirdischen Volk, dann müssen sie in einen Konflikt eingreifen, der sich auf einmal entwickelt. An Bord des Raumschiffes, dessen Besatzung vermitteln oder kämpfen soll, machen allerdings Intrigen die Arbeit unnötig kompliziert ...
Natürlich hängt alles irgendwie zusammen; die Handlung blendet zwischen den einzelnen Schauplätzen hin und her. Das macht die Regie echt gut. Mit Balthasar von Weymarn und Interplanar-Produktion sind jene Menschen für das Hörspiel verantwortlich, die bereits »Mark Brandis« so soll umgesetzt haben. Geräusche und Dialogregie stimmen, das ist alles klasse.
Für mich knifflig ist die Häufung von Militärsprech – das dauernde »Aye, Sir« und das Englisch nerven mich einfach. Dass auch Admirale sehr jung klingen, ist dem jungen Team geschuldet; damit komme ich klar. Und bei manchen Dialogen raschelt mir das Papier noch zu sehr – hier hätte man stärker eingreifen sollen.
Aber seien wir ehrlich: Wer Science-Fiction-Hörspiele mag, sollte »Heliosphere« eine Chance geben. Aber dann beim ersten Hörspiel anfangen ...
Unter anderem ins Hörspiel ... ich hörte dieser Tage endlich die CD »Zwischen den Welten«, den zweiten Teil der Hörspielserie. Weil ich seit der ersten CD eine so lange Pause eingelegt hatte, brauchte ich einige Zeit, bis ich wieder in die Handlung reinkam.
Viele Namen, die ich erst einsortieren musste, machten den Einstieg für mich durchaus schwierig. Wer sich für die Serie interessiert und mal reinhören möchte, sollte also auf jeden Fall mit dem ersten Hörspiel anfangen.
Die Handlung spielt auf dem Mars sowie in den Tiefen des Alls – das ist auch die Handlung, die ich spannender fand. Menschen von der Erde kommunizieren mit einem außerirdischen Volk, dann müssen sie in einen Konflikt eingreifen, der sich auf einmal entwickelt. An Bord des Raumschiffes, dessen Besatzung vermitteln oder kämpfen soll, machen allerdings Intrigen die Arbeit unnötig kompliziert ...
Natürlich hängt alles irgendwie zusammen; die Handlung blendet zwischen den einzelnen Schauplätzen hin und her. Das macht die Regie echt gut. Mit Balthasar von Weymarn und Interplanar-Produktion sind jene Menschen für das Hörspiel verantwortlich, die bereits »Mark Brandis« so soll umgesetzt haben. Geräusche und Dialogregie stimmen, das ist alles klasse.
Für mich knifflig ist die Häufung von Militärsprech – das dauernde »Aye, Sir« und das Englisch nerven mich einfach. Dass auch Admirale sehr jung klingen, ist dem jungen Team geschuldet; damit komme ich klar. Und bei manchen Dialogen raschelt mir das Papier noch zu sehr – hier hätte man stärker eingreifen sollen.
Aber seien wir ehrlich: Wer Science-Fiction-Hörspiele mag, sollte »Heliosphere« eine Chance geben. Aber dann beim ersten Hörspiel anfangen ...
16 Dezember 2019
Schreibpläne für 2020
Ich kann nicht behaupten, ich sei im Jahr 2019 unproduktiv gewesen, was meine Hobby-Schriftstellerei angeht. Immerhin habe ich es geschafft, meine Arbeit an »Totengräbers Tagebuch« – wo ich ja nur ein Co-Autor war – zu einem vernünftigen Ende zu bringen und auch einige Folgen von »Der Gute Geist des Rock'n'Roll« zu veröffentlichen. Leider hemmt mich mein eigentlicher Beruf sehr oft daran, meinen eigenen Kram zu schreiben.
Für 2020 habe ich mir bereits ernsthafte Vorsätze genommen. Unter anderem soll endlich meine Sammlung von Fantasy-Geschichten fertigwerden, die ich bereits Ende 2018 finalisieren wollte – oder war es gar 2017? Derzeit arbeite ich sehr ernsthaft an einer Science-Fiction-Geschichte, die hoffentlich bald fertig wird, dann folgt direkt darauf eine zweite. Für beide Geschichten gibt es Anthologien, in denen sie publiziert werden können.
Und ich habe mir völlig ernsthaft als Schreibprojekt für 2020 einen Science-Fiction-Roman vorgenommen. Nichts, was im Universum der größten SF-Serie der Welt spielt, sondern in meiner eigenen »Future History«. Ich will bisher weder etwas über den Inhalt noch über den potenziellen Verlag erzählen – ja, es gibt einen interessierten Verlag –, sondern nur andeuten, dass ich es mir ernsthaft vornehme.
Was daraus wird? Keine Ahnung. Nachdem 2019 sehr perrystressig war, sollte es 2020 wieder ein bisschen um meine eigenen Ideen und Gedankenwelten gehen. Wenn das mal kein guter Vorsatz ist!
Für 2020 habe ich mir bereits ernsthafte Vorsätze genommen. Unter anderem soll endlich meine Sammlung von Fantasy-Geschichten fertigwerden, die ich bereits Ende 2018 finalisieren wollte – oder war es gar 2017? Derzeit arbeite ich sehr ernsthaft an einer Science-Fiction-Geschichte, die hoffentlich bald fertig wird, dann folgt direkt darauf eine zweite. Für beide Geschichten gibt es Anthologien, in denen sie publiziert werden können.
Und ich habe mir völlig ernsthaft als Schreibprojekt für 2020 einen Science-Fiction-Roman vorgenommen. Nichts, was im Universum der größten SF-Serie der Welt spielt, sondern in meiner eigenen »Future History«. Ich will bisher weder etwas über den Inhalt noch über den potenziellen Verlag erzählen – ja, es gibt einen interessierten Verlag –, sondern nur andeuten, dass ich es mir ernsthaft vornehme.
Was daraus wird? Keine Ahnung. Nachdem 2019 sehr perrystressig war, sollte es 2020 wieder ein bisschen um meine eigenen Ideen und Gedankenwelten gehen. Wenn das mal kein guter Vorsatz ist!
15 Dezember 2019
Positive Erinnerung an die späten 60er-Jahre
Als ich im Spätjahr 2019 beim MaroVerlag einige Bücher bestellte, erhielt ich kostenlos die »Jahresgabe 2015 für die Freunde des MaroVerlages«. Ich freute mich sehr darüber, immerhin würde ich mich wirklich als ein Freund dieses Verlages bezeichnen – die ersten Maro-Bücher dürfte ich mir 1981 gekauft haben.
Die Jahresgabe erwies sich als ein Heft, 28 Seiten stark, im A5-Format und sehr schön gestaltet, das einen Text des Schriftstellers Gert Heidenreich enthielt: »Nächte mit Leonard« ist eine literarische Erinnerung an die Jahre 1968/69, die Heidenreich – er ist Jahrgang 1944 – sicher bewusster erlebt hat als ich. (Zu der Zeit war ich im Kindergarten.)
Der Autor schafft es, die spannenden Tage mit einem Sänger zu verbinden. Die Schüsse auf Rudi Dutschke, die Straßenschlachten von Paris und der Vietnamkrieg werden mit der Musik von Leonard Cohen in eine Reihe gestellt, das Lebensgefühl einer Generation wird in wenigen Zeilen lebendig. Heidenreich schreibt schwungvoll, sein Text liest sich leicht und mit viel Vergnügen.
Ein wunderbares Heft! Es macht mich auf den Schriftsteller neugierig, den ich bisher nicht großartig wahrgenommen habe – dankeschön an den MaroVerlag!
Die Jahresgabe erwies sich als ein Heft, 28 Seiten stark, im A5-Format und sehr schön gestaltet, das einen Text des Schriftstellers Gert Heidenreich enthielt: »Nächte mit Leonard« ist eine literarische Erinnerung an die Jahre 1968/69, die Heidenreich – er ist Jahrgang 1944 – sicher bewusster erlebt hat als ich. (Zu der Zeit war ich im Kindergarten.)
Der Autor schafft es, die spannenden Tage mit einem Sänger zu verbinden. Die Schüsse auf Rudi Dutschke, die Straßenschlachten von Paris und der Vietnamkrieg werden mit der Musik von Leonard Cohen in eine Reihe gestellt, das Lebensgefühl einer Generation wird in wenigen Zeilen lebendig. Heidenreich schreibt schwungvoll, sein Text liest sich leicht und mit viel Vergnügen.
Ein wunderbares Heft! Es macht mich auf den Schriftsteller neugierig, den ich bisher nicht großartig wahrgenommen habe – dankeschön an den MaroVerlag!
14 Dezember 2019
Keine Science Fiction mehr
In der Science Fiction gehört es seit vielen Jahren zum guten Ton, apokalyptische Szenarien zu entwickeln: das Ende der Menschheit im Brand des Atomkrieges, das Ende der Erde durch einen Meteoriten, neuerdings auch das Ende der Zivilisation durch die Klimakatastrophe. Wobei das für mich keine Science Fiction mehr ist, sondern ein Blick in eine nahe Realität.
Man kann meinetwegen sagen, dass der Klimawandel nicht von Menschen ausgelöst worden ist; diesen Glauben kann man ja vertreten. Es kann aber keiner bestreiten, dass die Umwelt immer schmutziger wird und das extreme Wetter zugenommen hat. Auf welches Phänomen man das schiebt, ist mir erst einmal gleichgültig – faktisch geht die Umwelt langsam vor die Hunde.
Nur scheint den meisten nach wie vor nicht so richtig klar zu sein, was das bedeutet. In Mitteleuropa können wir wohl gut mit dem Klimawandel umgehen. Steigt der Meeresspiegel um einen Meter, bauen wir halt die Dämme höher; man wird Norddeutschland nicht so schnell im Meer versacken lassen.
Was aber ist mit einem Land wie Bangladesh? Wenn der Meeresspiegel dort um einen Meter oder mehr steigt, werden Millionen von Menschen ertrinken, auf jeden Fall ihre Heimat verlieren. Es wird zu Fluchtbewegungen kommen, die alles übersteigen, was wir derzeit auf der Welt sehen. Das Gleiche gilt für weite Teile Afrikas, bei denen allerdings nicht unbedingt Überflutungen drohen, sondern noch mehr Dürre und noch mehr Hunger.
Wollen wir ernsthaft zuschauen, wie Millionen und Abermillionen Menschen in den nächsten zwanzig Jahren sterben werden? Nein: Hunderte von Millionen werden es sein, wenn auf der einen Seite der Meeresspiegel steigt und auf der anderen Seite das Land verdorrt.
Ich habe keine Lösung für diese Frage anzubieten, sie treibt mich aber um. Ich spende an »Ärzte ohne Grenzen« und andere Organisationen, die dabei mithelfen, die Katastrophen ein wenig abzumildern. Aber ich weiß nicht, was ich wirklich tun kann, um die Katastrophe aufzuhalten, die auf uns zukommt, oder ihre Folgen zumindest zu reduzieren.
Nur habe ich das Gefühl, dass den meisten Leuten eben dieser Gedankngang nicht bewusst ist. Nicht einmal denen, die sich für Klimaschutz einsetzen, damit aber vor allem meinen, dass uns das Thema in naher Zukunft betreffe. Es wird aber vor allem Leute in der sogenannten Dritten Welt treffen, die dann nicht einmal eine Chance haben werden, in sichere Länder zu fliehen.
Das ist dann alles keine Science Fiction mehr. Das ist bittere Wirklichkeit und mehr »No Future«, als ich mir das Ende der 70er- und anfangs der 80er-Jahre vorstellen konnte.
Man kann meinetwegen sagen, dass der Klimawandel nicht von Menschen ausgelöst worden ist; diesen Glauben kann man ja vertreten. Es kann aber keiner bestreiten, dass die Umwelt immer schmutziger wird und das extreme Wetter zugenommen hat. Auf welches Phänomen man das schiebt, ist mir erst einmal gleichgültig – faktisch geht die Umwelt langsam vor die Hunde.
Nur scheint den meisten nach wie vor nicht so richtig klar zu sein, was das bedeutet. In Mitteleuropa können wir wohl gut mit dem Klimawandel umgehen. Steigt der Meeresspiegel um einen Meter, bauen wir halt die Dämme höher; man wird Norddeutschland nicht so schnell im Meer versacken lassen.
Was aber ist mit einem Land wie Bangladesh? Wenn der Meeresspiegel dort um einen Meter oder mehr steigt, werden Millionen von Menschen ertrinken, auf jeden Fall ihre Heimat verlieren. Es wird zu Fluchtbewegungen kommen, die alles übersteigen, was wir derzeit auf der Welt sehen. Das Gleiche gilt für weite Teile Afrikas, bei denen allerdings nicht unbedingt Überflutungen drohen, sondern noch mehr Dürre und noch mehr Hunger.
Wollen wir ernsthaft zuschauen, wie Millionen und Abermillionen Menschen in den nächsten zwanzig Jahren sterben werden? Nein: Hunderte von Millionen werden es sein, wenn auf der einen Seite der Meeresspiegel steigt und auf der anderen Seite das Land verdorrt.
Ich habe keine Lösung für diese Frage anzubieten, sie treibt mich aber um. Ich spende an »Ärzte ohne Grenzen« und andere Organisationen, die dabei mithelfen, die Katastrophen ein wenig abzumildern. Aber ich weiß nicht, was ich wirklich tun kann, um die Katastrophe aufzuhalten, die auf uns zukommt, oder ihre Folgen zumindest zu reduzieren.
Nur habe ich das Gefühl, dass den meisten Leuten eben dieser Gedankngang nicht bewusst ist. Nicht einmal denen, die sich für Klimaschutz einsetzen, damit aber vor allem meinen, dass uns das Thema in naher Zukunft betreffe. Es wird aber vor allem Leute in der sogenannten Dritten Welt treffen, die dann nicht einmal eine Chance haben werden, in sichere Länder zu fliehen.
Das ist dann alles keine Science Fiction mehr. Das ist bittere Wirklichkeit und mehr »No Future«, als ich mir das Ende der 70er- und anfangs der 80er-Jahre vorstellen konnte.
13 Dezember 2019
Eine Weihnachtsgeschichte
Seit ich diesen Blog betreibe, schreibe ich immer wieder gern darüber, wenn ich irgendwelche Veröffentlichungen hinbekommen habe. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich einen Leserbrief in einem Fanzine veröffentliche oder einen Witz in der »Bäckerblume« (nicht, dass ich das jemals getan hätte, aber ...) – es müssen schon Veröffentlichungen sein, die für mich eine gewisse Relevanz haben.
Nächste Woche wird eine Weihnachtsgeschichte veröffentlicht, die ich bereits im Dezember 2017 geschrieben habe. Das Interessante dabei, wie ich finde: Die Geschichte erschien via Twitter, ich brachte also jeden Tag 280 Zeichen – inklusive der Hashtags – in einen Tweet, und diese Tweets bildeten eine Art Adventskalender. Die dabei entstehende Geschichte fand ich übrigens selbst gar nicht schlecht.
Ach so, der Titel: Die Geschichte heißt »Weihnachten am Goshunsee«, und es ist eine Geschichte aus dem PERRY RHODAN-Kosmos. Wir haben uns in der Redaktion also das Honorar für einen »richtigen« Autoren gespart und einfach den Redakteur schreiben lassen.
Und so komme ich in die relative Verlegenheit, in meinem privaten Blog auf eine Veröffentlichung im beruflichen Umfeld hinzuweisen. Da ich die Tweets eh in meiner Freizeit geschrieben habe, passt das auch wieder, denke ich ...
Nächste Woche wird eine Weihnachtsgeschichte veröffentlicht, die ich bereits im Dezember 2017 geschrieben habe. Das Interessante dabei, wie ich finde: Die Geschichte erschien via Twitter, ich brachte also jeden Tag 280 Zeichen – inklusive der Hashtags – in einen Tweet, und diese Tweets bildeten eine Art Adventskalender. Die dabei entstehende Geschichte fand ich übrigens selbst gar nicht schlecht.
Ach so, der Titel: Die Geschichte heißt »Weihnachten am Goshunsee«, und es ist eine Geschichte aus dem PERRY RHODAN-Kosmos. Wir haben uns in der Redaktion also das Honorar für einen »richtigen« Autoren gespart und einfach den Redakteur schreiben lassen.
Und so komme ich in die relative Verlegenheit, in meinem privaten Blog auf eine Veröffentlichung im beruflichen Umfeld hinzuweisen. Da ich die Tweets eh in meiner Freizeit geschrieben habe, passt das auch wieder, denke ich ...
12 Dezember 2019
Sedlmeir ausm Jahr 2017
Mit dem Musiker und Sänger Sedlmeir konnte ich mich anfangs nicht anfreunden. Weder die Musik noch die Texte gingen so richtig in meinen Kopf, und das gilt auch für die Platte »Fluchtpunkt Risiko«, die bereits im Herbst 2017 veröffentlicht wurde. Mittlerweile habe ich sie mir erneut angehört, nicht einmal, sondern mehrfach, und da gefiel sie mir deutlich besser.
Woher mein Gesinnungswandel kommt, kann ich im Nachhinein nicht mehr sagen. Für jegliche Musik gibt es eben eine Zeit, in die sie passt; das ist in diesem Fall wohl auch so. Und da sich Sedlmeir musikalisch zwischen allerlei Stühle setzt, komme ich da nicht immer mit klar.
Der Mann wildert in allen möglichen Gefilden. Die Gitarre klingt manchmal wie in einer Hardrock-Band, das Schlagzeug scheppert zum Ausgleich wie beim Kirmes-Techno. Manche Stücke klingen wie Balladen, andere wie gebremster Hardrock. Er macht auf jeden Fall keinen Liedermacher-Pop, biedert sich damit nicht bei aktuellen Moden an – das ist zu respektieren.
Die Stimme klingt immer lässig, die Texte sind lakonisch und gefallen mir nicht immer. In sarkastischem Ton werden Alltagsgeschichten erzählt, während beinhart-politische Themen umschifft werden. Das ist oft geschickt formuliert, nicht immer genial, aber dennoch sehr häufig überzeugend in seiner Art. In seiner eigenwilligen Art ist Sedlmeir dann eben doch Punk.
Seien wir ehrlich: Ein Sedlmeir-Fan bin ich noch nicht. Aber ich verstehe immerhin, warum den Musiker und Sänger viele Leute mögen.
Woher mein Gesinnungswandel kommt, kann ich im Nachhinein nicht mehr sagen. Für jegliche Musik gibt es eben eine Zeit, in die sie passt; das ist in diesem Fall wohl auch so. Und da sich Sedlmeir musikalisch zwischen allerlei Stühle setzt, komme ich da nicht immer mit klar.
Der Mann wildert in allen möglichen Gefilden. Die Gitarre klingt manchmal wie in einer Hardrock-Band, das Schlagzeug scheppert zum Ausgleich wie beim Kirmes-Techno. Manche Stücke klingen wie Balladen, andere wie gebremster Hardrock. Er macht auf jeden Fall keinen Liedermacher-Pop, biedert sich damit nicht bei aktuellen Moden an – das ist zu respektieren.
Die Stimme klingt immer lässig, die Texte sind lakonisch und gefallen mir nicht immer. In sarkastischem Ton werden Alltagsgeschichten erzählt, während beinhart-politische Themen umschifft werden. Das ist oft geschickt formuliert, nicht immer genial, aber dennoch sehr häufig überzeugend in seiner Art. In seiner eigenwilligen Art ist Sedlmeir dann eben doch Punk.
Seien wir ehrlich: Ein Sedlmeir-Fan bin ich noch nicht. Aber ich verstehe immerhin, warum den Musiker und Sänger viele Leute mögen.
Ein Bildband präsentiert den »Storm«-Meister
Im Frühjahr 2016 erschien ein Buch, das auf 1111 Exemplare limitiert wurde und deshalb beim Verlag bereits als vergriffen gemeldet worden ist. Dass ich heute erst dazu komme, etwas dazu zu schreiben, wollen wir an dieser Stelle lieber nicht diskutieren ...
Die Rede ist von »Storm – das Vermächtnis«, einem dickleibigen Band, der Werke von Don Lawrence präsentiert. Veröffentlicht wurde es im Splitter-Verlag, bei dem »Storm« bekanntlich eine neue Heimat gefunden hat.
Ganz klar: Das ist kein Buch, das man liest, wenngleich es ergänzende Texte gibt. Das ist ein Buch, das man zur Seite legt, das man immer mal wieder durchblättert, in dem man vorne und hinten guckt und das man irgendwann mit einem Gesichtsausdruck der Zufriedenheit ins Regal stellt. Ein Prachtband eben, und er ist einem der größten Comic-Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts durchaus angemessen.
Don Lawrence wurde mit den Serien »Trigan« und »Storm« berühmt, vor allem deshalb, weil er einen unglaublich realitätsnahen Stil pflegte. Seine Menschen waren zwar manchmal eine Spur zu »teutonisch-heldisch«, wurden von ihm aber immer beeindruckend dargestellt. Manchmal wirkten die Hintergründe, die Gebäude oder die Landschaften wie Fotos – wenn ich mir diese Comics anschaute, waren mir die Geschichten oftmals egal.
Das Buch zeigt auf gut 250 Seiten eine Sammlung von Farb- und Schwarzweiß-Zeichnungen des Künstlers. Teilweise stammen sie aus dem Nachlass, einige Bilder wurden auch schon veröffentlicht. Manche Skizzen sind nichts anderes als Fingerübungen, oftmals gibt es erotische Darstellungen zu sehen, vieles bleibt dabei nur flüchtig. Die wenigen Farbbilder haben sogar eine ironisch-satirische Note.
Wie es sich für ein Buch aus dem Splitter-Verlag gehört, ist auch »Storm – das Vermächtnis« ein echter Prachtband. Der Umschlag ist aufwendig gestaltet, die einzelnen Seiten sind hervorragend gedruckt; es handelt sich bei diesem Bildband um ein Buch, das man gern in die Hand nimmt und auch nach Jahren mit großem Interesse betrachten wird.
Der stolze Preis für das Buch ist angesichts der Aufmachung und der geringen Auflage berechtigt. (Und wer sich dafür interessiert, muss ein wenig suchen. Es gibt noch Internet-Shops, die das Buch als »lieferbar« auflisten.)
Die Rede ist von »Storm – das Vermächtnis«, einem dickleibigen Band, der Werke von Don Lawrence präsentiert. Veröffentlicht wurde es im Splitter-Verlag, bei dem »Storm« bekanntlich eine neue Heimat gefunden hat.
Ganz klar: Das ist kein Buch, das man liest, wenngleich es ergänzende Texte gibt. Das ist ein Buch, das man zur Seite legt, das man immer mal wieder durchblättert, in dem man vorne und hinten guckt und das man irgendwann mit einem Gesichtsausdruck der Zufriedenheit ins Regal stellt. Ein Prachtband eben, und er ist einem der größten Comic-Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts durchaus angemessen.
Don Lawrence wurde mit den Serien »Trigan« und »Storm« berühmt, vor allem deshalb, weil er einen unglaublich realitätsnahen Stil pflegte. Seine Menschen waren zwar manchmal eine Spur zu »teutonisch-heldisch«, wurden von ihm aber immer beeindruckend dargestellt. Manchmal wirkten die Hintergründe, die Gebäude oder die Landschaften wie Fotos – wenn ich mir diese Comics anschaute, waren mir die Geschichten oftmals egal.
Das Buch zeigt auf gut 250 Seiten eine Sammlung von Farb- und Schwarzweiß-Zeichnungen des Künstlers. Teilweise stammen sie aus dem Nachlass, einige Bilder wurden auch schon veröffentlicht. Manche Skizzen sind nichts anderes als Fingerübungen, oftmals gibt es erotische Darstellungen zu sehen, vieles bleibt dabei nur flüchtig. Die wenigen Farbbilder haben sogar eine ironisch-satirische Note.
Wie es sich für ein Buch aus dem Splitter-Verlag gehört, ist auch »Storm – das Vermächtnis« ein echter Prachtband. Der Umschlag ist aufwendig gestaltet, die einzelnen Seiten sind hervorragend gedruckt; es handelt sich bei diesem Bildband um ein Buch, das man gern in die Hand nimmt und auch nach Jahren mit großem Interesse betrachten wird.
Der stolze Preis für das Buch ist angesichts der Aufmachung und der geringen Auflage berechtigt. (Und wer sich dafür interessiert, muss ein wenig suchen. Es gibt noch Internet-Shops, die das Buch als »lieferbar« auflisten.)
11 Dezember 2019
Wirtschaftliche Fragen
Ich finde es – angesichts aktueller Diskussionen – immer wieder spannend, welche wirtschaftlichen Ziele unsere Regierung verfolgt. Auch das Parlament ... ich weiß, dass ich keine Ahnung von solchen komplexen Zusammenhängen habe, vermute aber, dass in den von mir genannten Institutionen auch nicht viel mehr Ahnung herrscht.
Man lässt die Branche der Windenergie gnadenlos verrecken; dass Tausende von Arbeitsplätzen innerhalb kürzester Zeit verloren gegangen sind, hat bei den Regierenden in Berlin offenbar niemanden interessiert. Für jeden Beschäftigten der Stein- und der Braunkohle wird aber erbittert gestritten.
Urlauber, die von der Thomas-Cook-Pleite betroffen sind, sollen ihr Geld vom Staat zurück erhalten. Zuletzt hat der Staat für mehrere Milliarden den Autofahrern dabei geholfen, sich einen neuen Fuhrpark zuzulegen. Als die Solarindustrie nicht mehr funktionierte, interessierte das niemanden. Das kostete Arbeitsplätze und vor allem industrielle Standorte.
Die Hilfe für die Thomas-Cook-Reisenden sieht zwar aus wie eine noble Geste, stößt bei mir aber auch auf ein gewisses Unverständnis. Grundsätzlich ist es ja gut, wenn der Staat beispielsweise Bauern hilft, denen bei einem Orkan die Ernte vernichtet worden ist.
Aber wieso wird jemandem geholfen, der bei einer Reisegesellschaft eine Reise gebut hat, ohne sich abzusichern, und nun auf seinen Ausgaben hocken bleibt? Bekomme ich dann künftig auch mein Geld zurück, wenn ich Fondsanteile kaufe und der Fonds drastisch an Wert verliert?
Ich verstehe es schlichtweg nicht: Es hat nichts mit sozialer Marktwirtschaft zu tun, nichts mit Industrieförderung, nichts mit all den Dingen, für die unsere dufte Bundesregierung sonst so eintritt. Warum werden also nach einem seltsamen Gießkannenprinzip die einen gefördert und die anderen nicht?
Die Antwort will ich gar nicht hören. Ich vermute eh, dass sie mehr nach einer Verschwörungstheorie klänge als nach nachvollziehbaren Gründen.
Man lässt die Branche der Windenergie gnadenlos verrecken; dass Tausende von Arbeitsplätzen innerhalb kürzester Zeit verloren gegangen sind, hat bei den Regierenden in Berlin offenbar niemanden interessiert. Für jeden Beschäftigten der Stein- und der Braunkohle wird aber erbittert gestritten.
Urlauber, die von der Thomas-Cook-Pleite betroffen sind, sollen ihr Geld vom Staat zurück erhalten. Zuletzt hat der Staat für mehrere Milliarden den Autofahrern dabei geholfen, sich einen neuen Fuhrpark zuzulegen. Als die Solarindustrie nicht mehr funktionierte, interessierte das niemanden. Das kostete Arbeitsplätze und vor allem industrielle Standorte.
Die Hilfe für die Thomas-Cook-Reisenden sieht zwar aus wie eine noble Geste, stößt bei mir aber auch auf ein gewisses Unverständnis. Grundsätzlich ist es ja gut, wenn der Staat beispielsweise Bauern hilft, denen bei einem Orkan die Ernte vernichtet worden ist.
Aber wieso wird jemandem geholfen, der bei einer Reisegesellschaft eine Reise gebut hat, ohne sich abzusichern, und nun auf seinen Ausgaben hocken bleibt? Bekomme ich dann künftig auch mein Geld zurück, wenn ich Fondsanteile kaufe und der Fonds drastisch an Wert verliert?
Ich verstehe es schlichtweg nicht: Es hat nichts mit sozialer Marktwirtschaft zu tun, nichts mit Industrieförderung, nichts mit all den Dingen, für die unsere dufte Bundesregierung sonst so eintritt. Warum werden also nach einem seltsamen Gießkannenprinzip die einen gefördert und die anderen nicht?
Die Antwort will ich gar nicht hören. Ich vermute eh, dass sie mehr nach einer Verschwörungstheorie klänge als nach nachvollziehbaren Gründen.
10 Dezember 2019
Wie ich einmal Fotomodell war ...
 Aus der Serie »Ein Bild und seine Geschichte«
Aus der Serie »Ein Bild und seine Geschichte«Das Frühjahr 1990 wies einige kühle Tage auf. An einem dieser Tage fuhren zwei Kollegen und ich zu einer Spedition im bayerisch-schwäbischen Grenzgebiet. Es ging darum, viele Fotos anzufertigen, die wir für eine Broschüre brauchten.
In der Agentur, für die ich tätig war, hatten wir nämlich den Auftrag, »Informationen für Lastwagenfahrer« zu gestalten, die eine Versicherung unter die Leute bringen wollte. Ein spannendes Thema, fand ich.
Ich sollte die Texte schreiben, also führte ich eine Reihe von Interviews. Ein Kollege fotografierte, ein anderer dirigierte Lastwagenfahrer über einen Parcours, wo sie allerlei gefährliche Situationen nachzustellen hatten. Bei kühlem Frühlingswetter machte das zwar durchaus Spaß, dauerte aber auch richtig lange.
Irgendwann brauchten wir einen Mann – an Frauen in diesem Beruf dachte an diesem Tag keiner der Anwesenden, weder wir Schreiberlinge noch die Spediteure –, der zeigte, wie man einen LKW ordnungsgemäß einweist. Die Wahl fiel auf mich.
Und so stand ich auf dem Gelände, in der Stoffhose und den Halbschuhen eines Büroangestellten, und tat so, als sei ich der Gehilfe eines Lastwagenfahrers. Es war nicht der dümmste Auftrag, den ich zu erledigen hatte. Aber ein wenig dämlich fand ich mich schon ...
09 Dezember 2019
Unterwegs zum Service
Eigentlich wollte ich nur mein Rad vor dem Winter zum Service bringen. Noch einmal alle Schrauben nachziehen, noch einmal die beweglichen Teile prüfen und gegebenenfalls die Kette erneuern. Das nahm ich mir jedes Jahr vor, es klappte nur nicht immer.
Als ich vor dem Gebäude ankam, in dessen Erdgeschoss sich die Werkstatt befand, war ich völlig verblüfft. Wo früher ein Mann mittleren Alters arbeitete, hatte man neuerdings eine kleine Café-Bar eröffnet. Der Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee hing in der Luft, einige Leute saßen an winzigen Tischen, und hinter dem Tresen stand eine junge Frau in schwarzer Kleidung. Verwundert trat ich zu ihr und fragte, wo denn der Fahrradladen sei.
Sie zeigte mir den Weg: aus dem Café hinaus, zur Hälfte um das Gebäude herum, dann eine Treppe hinunter. »Eine Treppe?«, fragte ich nach, und sie nickte nur. Ich bedankte mich und ging. Mein Fahrrad ließ ich offenbar zurück.
Ich nahm die Treppe nach unten, traf dort in einem weiteren Raum ein. Er war leer, nur ein Mann in grauem Kittel stand darin und schien auf mich zu warten. Er wies nach hinten. »Da lang«, sagte er lakonisch.
Ich erkannte ein Loch in der Wand, das so aussah, als habe man sich mit einem Vorschlaghammer den Weg freigehauen. »Wie in der alten ›Steffi‹ im Konzertraum«, sagte ich zu dem Mann, der mich nur ausdruckslos betrachtete.
Nachdem ich das Loch hinter mich gelassen hatte, stand ich in einem offenen Flur. Nach oben führte eine Rolltreppe, die mit Müll übersät war; auf jeder Stufe lagen leere Tetrapacks und Bierdosen, Orangenschalen und zerfetzte Plastiktüten. Von unten wurde unaufhörlich weiterer Müll auf die Rolltreppe gespuckt, wie mir schien, und oben türmte sich der Müll zu einem immer größer werdenden Haufen.
Ich ignorierte den Dreck, so weit es mir möglich war, und schob ihn ein wenig zur Seite. Dann stand ich auf der Rolltreppe und ließ mich nach oben tragen. Es wurde heller, je höher ich kam.
Und dann wachte ich auf. Ohne Fahrrad.
Als ich vor dem Gebäude ankam, in dessen Erdgeschoss sich die Werkstatt befand, war ich völlig verblüfft. Wo früher ein Mann mittleren Alters arbeitete, hatte man neuerdings eine kleine Café-Bar eröffnet. Der Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee hing in der Luft, einige Leute saßen an winzigen Tischen, und hinter dem Tresen stand eine junge Frau in schwarzer Kleidung. Verwundert trat ich zu ihr und fragte, wo denn der Fahrradladen sei.
Sie zeigte mir den Weg: aus dem Café hinaus, zur Hälfte um das Gebäude herum, dann eine Treppe hinunter. »Eine Treppe?«, fragte ich nach, und sie nickte nur. Ich bedankte mich und ging. Mein Fahrrad ließ ich offenbar zurück.
Ich nahm die Treppe nach unten, traf dort in einem weiteren Raum ein. Er war leer, nur ein Mann in grauem Kittel stand darin und schien auf mich zu warten. Er wies nach hinten. »Da lang«, sagte er lakonisch.
Ich erkannte ein Loch in der Wand, das so aussah, als habe man sich mit einem Vorschlaghammer den Weg freigehauen. »Wie in der alten ›Steffi‹ im Konzertraum«, sagte ich zu dem Mann, der mich nur ausdruckslos betrachtete.
Nachdem ich das Loch hinter mich gelassen hatte, stand ich in einem offenen Flur. Nach oben führte eine Rolltreppe, die mit Müll übersät war; auf jeder Stufe lagen leere Tetrapacks und Bierdosen, Orangenschalen und zerfetzte Plastiktüten. Von unten wurde unaufhörlich weiterer Müll auf die Rolltreppe gespuckt, wie mir schien, und oben türmte sich der Müll zu einem immer größer werdenden Haufen.
Ich ignorierte den Dreck, so weit es mir möglich war, und schob ihn ein wenig zur Seite. Dann stand ich auf der Rolltreppe und ließ mich nach oben tragen. Es wurde heller, je höher ich kam.
Und dann wachte ich auf. Ohne Fahrrad.
08 Dezember 2019
Kellerasseln mögen Mittelmeerromantik
Ein keifender Sänger, ein unglaublich schrabbeliger Sound: Die Kellerasseln aus Erfurt sind definitiv Punk.
Die Band gibt es seit Ende der 90er-Jahre, wenn ich mich nicht ganz irre, und sie hat an ihrem Sound grundsätzlich nicht viel geändert. Man ist knallig und wüst, man setzt auf ratterndes Schlagzeug, knallige Gitarren und einen im Hintergrund wummernden Bass, dazu der eben genannte Sänger.
Auch wenn der Name der Band es nahelegt – so richtiger Deutschpunk ist das nicht, sondern viel schrubbiger. Was das angeht, sind die Kellerasseln sehr konsequent, und das finde ich schon wieder respektabel. Täglich reinknallen mag ich mir diese Musik allerdings nicht
Ich habe mir die EP »Mittelmeerromantik« vom Januar 2015 angehört. Sowohl der zynische Titel als auch das Cover spielen auf die ertrunkenen Migranten im Mittelmeer an. Auch textlich macht die Band klar, wo sie inhaltlich steht: In den insgesamt fünf kurzen, unglaublich knappen Stücken geht's um Konsum- und Warenkritik sowie um Politik, allerdings ohne Parolen, sondern in ziemlich sarkastischer Art und Weise.
Die Vinylscheibe ist übrigens richtig toll gestaltet: Man hat sogar ein Bändchen geflochten, das durch das Loch in der Scheibe gezogen worden ist. (Das macht's mir natürlich schwer, die Platte im Radio zu spielen, weil ich davor und danach mit dem Bändchen eine echte Fummelarbeit habe.) Textblätter und dergleichen ergänzen die schöne Optik.
Aber wer darauf keinen Wert legt, findet die Platte auch bei Bandcamp. Dort kann man das Werk der Band legal anhören und ebenso legal kaufen.
Die Band gibt es seit Ende der 90er-Jahre, wenn ich mich nicht ganz irre, und sie hat an ihrem Sound grundsätzlich nicht viel geändert. Man ist knallig und wüst, man setzt auf ratterndes Schlagzeug, knallige Gitarren und einen im Hintergrund wummernden Bass, dazu der eben genannte Sänger.
Auch wenn der Name der Band es nahelegt – so richtiger Deutschpunk ist das nicht, sondern viel schrubbiger. Was das angeht, sind die Kellerasseln sehr konsequent, und das finde ich schon wieder respektabel. Täglich reinknallen mag ich mir diese Musik allerdings nicht
Ich habe mir die EP »Mittelmeerromantik« vom Januar 2015 angehört. Sowohl der zynische Titel als auch das Cover spielen auf die ertrunkenen Migranten im Mittelmeer an. Auch textlich macht die Band klar, wo sie inhaltlich steht: In den insgesamt fünf kurzen, unglaublich knappen Stücken geht's um Konsum- und Warenkritik sowie um Politik, allerdings ohne Parolen, sondern in ziemlich sarkastischer Art und Weise.
Die Vinylscheibe ist übrigens richtig toll gestaltet: Man hat sogar ein Bändchen geflochten, das durch das Loch in der Scheibe gezogen worden ist. (Das macht's mir natürlich schwer, die Platte im Radio zu spielen, weil ich davor und danach mit dem Bändchen eine echte Fummelarbeit habe.) Textblätter und dergleichen ergänzen die schöne Optik.
Aber wer darauf keinen Wert legt, findet die Platte auch bei Bandcamp. Dort kann man das Werk der Band legal anhören und ebenso legal kaufen.
07 Dezember 2019
Fehler, zu spät entdeckt
Als Redakteur bin ich darauf trainiert, Fehler in den Manuskripten anderer Menschen zu finden. Manchmal muss ich nur draufschauen, und ich finde etwas, das nicht stimmt: Rechtschreib- oder Grammatikfehler, gröbere stilistische Schnitzer, inhaltliche Abweichungen zwischen Szenen und Kapitel. Das ist berufliche Routine, ausgebildet in vielen Jahren.
Bei meinen eigenen Texten bin ich nicht so gut, wie mir immer wieder auffällt. Vor allem bei Fortsetzungsgeschichten verliere ich selbst den Überblick. Besonders schön ist das derzeit bei »Der gute Geist des Rock'n'Roll«, dem aktuellen Punkrock-Fortsetzungsroman, den ich für das OX schreibe. Die Serie läuft seit einiger Zeit, sie spielt im Jahr 1996.
Nicht nur, dass ich zwischendurch vergessen habe, welche Fußballspiele der Europameisterschaft zu welchem Zeitpunkt ausgetragen wurden – das ist in diesem Roman von einiger Relevanz –, ich habe es geschafft, die Wohnung des Ich-Erzählers zu vertauschen. Anfangs wohnt er definitiv in einer anderen Wohnung als später; die Beschreibungen weichen stark voneinander ab.
Grund dafür ist meine eigene Faulheit: Meine Wohnung in der Hirschstraße in Karlsruhe, die ich von 1998 bis 2001 bewohnte, ist eigentlich der Schauplatz der Geschichte. Zwischendurch wechselt die Beschreibung aber zu der Wohnung in der Leopoldstraße, die ich zwischen 1994 und 1998 als meine Heimat bezeichnete.
Wie ich das wieder auf die Reihe bekomme, weiß ich noch nicht. Für das weitere Schreiben des Romans muss ich mich auf eine einheitliche Beschreibung konzentrieren. Und wenn daraus in zehn Jahren mal ein Buch werden sollte, muss ich halt entsprechend umarbeiten. So viel zum Thema »vorheriges Denken vermeidet späteres Nacharbeiten« ...
Bei meinen eigenen Texten bin ich nicht so gut, wie mir immer wieder auffällt. Vor allem bei Fortsetzungsgeschichten verliere ich selbst den Überblick. Besonders schön ist das derzeit bei »Der gute Geist des Rock'n'Roll«, dem aktuellen Punkrock-Fortsetzungsroman, den ich für das OX schreibe. Die Serie läuft seit einiger Zeit, sie spielt im Jahr 1996.
Nicht nur, dass ich zwischendurch vergessen habe, welche Fußballspiele der Europameisterschaft zu welchem Zeitpunkt ausgetragen wurden – das ist in diesem Roman von einiger Relevanz –, ich habe es geschafft, die Wohnung des Ich-Erzählers zu vertauschen. Anfangs wohnt er definitiv in einer anderen Wohnung als später; die Beschreibungen weichen stark voneinander ab.
Grund dafür ist meine eigene Faulheit: Meine Wohnung in der Hirschstraße in Karlsruhe, die ich von 1998 bis 2001 bewohnte, ist eigentlich der Schauplatz der Geschichte. Zwischendurch wechselt die Beschreibung aber zu der Wohnung in der Leopoldstraße, die ich zwischen 1994 und 1998 als meine Heimat bezeichnete.
Wie ich das wieder auf die Reihe bekomme, weiß ich noch nicht. Für das weitere Schreiben des Romans muss ich mich auf eine einheitliche Beschreibung konzentrieren. Und wenn daraus in zehn Jahren mal ein Buch werden sollte, muss ich halt entsprechend umarbeiten. So viel zum Thema »vorheriges Denken vermeidet späteres Nacharbeiten« ...
06 Dezember 2019
Experimentelle Lyrik
Ich war 17 Jahre alt, und ich glaubte, ein guter Autor zu sein. Im Sommer 1981 ging ich wieder auf die Schule, nachdem ich ein Jahr mit einer angefangenen Lehre verschwendet hatte. Ich gewann neue Freunde, und ich interessierte mich für literarische Experimente.
Eines davon war, mit Wörtern fleißig zu assoziieren. Ich wollte »assoziative Gedichte« schreiben, ich versuchte mich an »Cut-Up-Texten« oder dem, was ich dafür hielt. In meinem Zimmer unter dem Dach meines Elternhauses in unserem Schwarzwalddorf brütete ich Dinge aus, die ich heute nicht mehr verstehe.
Ein Text, der sich mit der »assoziativen Lyrik« beschäftigte, ist erhalten geblieben. Ich tippte »Asso I« am 25. September 1981 ab – man kann davon ausgehen, dass ihm weitere folgen sollten. Vielleicht folgten ihm auch weitere Texte, die aber nicht erhalten sind.
Sicher könnte man über diese Zeilen eifrig Psychoanalyse betreiben – muss man aber nicht. Mit dem Abstand einiger Jahrzehnte finde ich sie immerhin interessant und sogar spannend.
Asso I
Hunde bellen hinter Höfen
Verkümmertes Land
Zigarettenasche in meinem Hirn
Hohlkörper Wasser im Sonnenlicht
Mädchen aus Rein-Gar-Nichts
Und diffuse Gestalten am Morgen
Paranoia 21
Zottige Gestalten über schwarzen Klippen
Pervertierte, Ausgestoßene im Ungewissen,
Einsame im Dunkeln.
Phallusketten,
zerfetzt und niedergewalzt.
Schönes Herz
Wild pulsierende Wärme,
krachende Kälte
Knochenbrecher
mattglitzernd und todbringend
Zurück ins Nirgendwo
Farbenfroher Vorhang.
Eines davon war, mit Wörtern fleißig zu assoziieren. Ich wollte »assoziative Gedichte« schreiben, ich versuchte mich an »Cut-Up-Texten« oder dem, was ich dafür hielt. In meinem Zimmer unter dem Dach meines Elternhauses in unserem Schwarzwalddorf brütete ich Dinge aus, die ich heute nicht mehr verstehe.
Ein Text, der sich mit der »assoziativen Lyrik« beschäftigte, ist erhalten geblieben. Ich tippte »Asso I« am 25. September 1981 ab – man kann davon ausgehen, dass ihm weitere folgen sollten. Vielleicht folgten ihm auch weitere Texte, die aber nicht erhalten sind.
Sicher könnte man über diese Zeilen eifrig Psychoanalyse betreiben – muss man aber nicht. Mit dem Abstand einiger Jahrzehnte finde ich sie immerhin interessant und sogar spannend.
Asso I
Hunde bellen hinter Höfen
Verkümmertes Land
Zigarettenasche in meinem Hirn
Hohlkörper Wasser im Sonnenlicht
Mädchen aus Rein-Gar-Nichts
Und diffuse Gestalten am Morgen
Paranoia 21
Zottige Gestalten über schwarzen Klippen
Pervertierte, Ausgestoßene im Ungewissen,
Einsame im Dunkeln.
Phallusketten,
zerfetzt und niedergewalzt.
Schönes Herz
Wild pulsierende Wärme,
krachende Kälte
Knochenbrecher
mattglitzernd und todbringend
Zurück ins Nirgendwo
Farbenfroher Vorhang.
05 Dezember 2019
Wie der Hohenheim-Verlag warb
In den frühen 80er-Jahre gab es im deutschsprachigen Raum einen unglaublichen Boom an Science Fiction: Viele Klassiker kamen in Neuübersetzungen auf den Markt, viele Verlage bauten ihr Angebot aus. Es gab ein Dutzend Heftromane, die regelmäßig in den Handel geschoben wurden, dazu kamen zahlreiche Reihen bei den einschlägigen Taschenbuchverlagen wie Heyne, Goldmann oder Bastei-Lübbe.
In dieser Zeit begann auch der Hohenheim-Verlag mit seinem Programm. Der Verlag veröffentlichte allgemeinen Literatur unterschiedlicher Qualitäten, setzte aber von Anfang an auf Science Fiction. Schaut man sich die Anzeigen aus dieser Zeit an, kann man hoffentlich noch verstehe, wie das anfangs der 80er-Jahre die Science-Fiction-Fans faszinierte. Die Bücher kamen als Hardcover mit Schutzumschlag – das war etwas ganz anderes als die sonst üblichen Heftromane und eher schlapp wirkenden Taschenbücher.
Einige der Bücher kaufte ich, einige erhielt ich als Rezensionsexemplare, manche davon stehen noch heute in meinem Regal. Der Roman von Lyon Sprague de Camp, der in der Anzeige genannt wird, war eher enttäuschend, den verschenkte ich irgendwann. Robert Sheckleys Kurzgeschichten mochte ich schon, also behielt ich das Buch – vielleicht sollte ich einmal wieder hineinschauen.
»Die besten SF-Stories der fünfziger Jahre« – damals schrieb man das englische Wort »Storys« in der englischen Originalversion und nicht eingedeutscht und mit deutschen Rechtschreibregeln. Das Buch wurde von Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs zusammengestellt und präsentierte in der Tat hervorragende Geschichten. Die Handvoll Anthologien, die anfangs der 80er-Jahre im Hohenheim-Verlag veröffentlicht wurden, prägten entscheidend mein Bild der englischsprachigen Science Fiction.
Großartig fand ich auch »Gestalter der Zukunft« von Charles Platt. Reportagen über die bekanntesten Science-Fiction-Autoren waren das, in einem journalistischen Stil geschrieben, also nicht einfache Frage-und-Antwort-Spielchen, sondern Reportagen, die einem auch einen Eindruck von den Menschen, ihren Gewohnheiten und Ansichten vermittelten. Das Buch hielt ich in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder in der Hand; mit solchen Büchern hat sich der Hohenheim für alle Zeiten in meinem Gedächtnis verankert.
Leider hat sich der Verlag ja irgendwann in der Mitte der 80er-Jahre aufgelöst. Was blieb, sind schöne Bücher, eine tolle Anthologie-Reihe und vor allem einige Anzeigen, die mir ab und zu aus alten Fanzines entgegenstrahlen …
In dieser Zeit begann auch der Hohenheim-Verlag mit seinem Programm. Der Verlag veröffentlichte allgemeinen Literatur unterschiedlicher Qualitäten, setzte aber von Anfang an auf Science Fiction. Schaut man sich die Anzeigen aus dieser Zeit an, kann man hoffentlich noch verstehe, wie das anfangs der 80er-Jahre die Science-Fiction-Fans faszinierte. Die Bücher kamen als Hardcover mit Schutzumschlag – das war etwas ganz anderes als die sonst üblichen Heftromane und eher schlapp wirkenden Taschenbücher.
Einige der Bücher kaufte ich, einige erhielt ich als Rezensionsexemplare, manche davon stehen noch heute in meinem Regal. Der Roman von Lyon Sprague de Camp, der in der Anzeige genannt wird, war eher enttäuschend, den verschenkte ich irgendwann. Robert Sheckleys Kurzgeschichten mochte ich schon, also behielt ich das Buch – vielleicht sollte ich einmal wieder hineinschauen.
»Die besten SF-Stories der fünfziger Jahre« – damals schrieb man das englische Wort »Storys« in der englischen Originalversion und nicht eingedeutscht und mit deutschen Rechtschreibregeln. Das Buch wurde von Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs zusammengestellt und präsentierte in der Tat hervorragende Geschichten. Die Handvoll Anthologien, die anfangs der 80er-Jahre im Hohenheim-Verlag veröffentlicht wurden, prägten entscheidend mein Bild der englischsprachigen Science Fiction.
Großartig fand ich auch »Gestalter der Zukunft« von Charles Platt. Reportagen über die bekanntesten Science-Fiction-Autoren waren das, in einem journalistischen Stil geschrieben, also nicht einfache Frage-und-Antwort-Spielchen, sondern Reportagen, die einem auch einen Eindruck von den Menschen, ihren Gewohnheiten und Ansichten vermittelten. Das Buch hielt ich in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder in der Hand; mit solchen Büchern hat sich der Hohenheim für alle Zeiten in meinem Gedächtnis verankert.
Leider hat sich der Verlag ja irgendwann in der Mitte der 80er-Jahre aufgelöst. Was blieb, sind schöne Bücher, eine tolle Anthologie-Reihe und vor allem einige Anzeigen, die mir ab und zu aus alten Fanzines entgegenstrahlen …
Ein telefonbuchdickes Fanzine
Groß war meine Überraschung über die aktuelle Ausgabe des altehrwürdigen Fanzines »Andromeda Nachrichten«. Als ich vor vielen Jahrzehnten in den Science-Fiction-Club Deutschland e.V. eintrat, war das Fanzine ein Fanzine im A5-Format, das durch eher schlichtes Layout und einen überschaubaren Umfang auffiel.
 Die nun vorliegende Ausgabe 267 ist unfassbare 216 Seiten dick, im A4-Format, und das Layout sieht bei alledem auch noch sehr ordentlich aus, vielleicht ein wenig langweilig, aber stets übersichtlich und gut lesbar. Das war früher in jeglicher Hinsicht anders.
Die nun vorliegende Ausgabe 267 ist unfassbare 216 Seiten dick, im A4-Format, und das Layout sieht bei alledem auch noch sehr ordentlich aus, vielleicht ein wenig langweilig, aber stets übersichtlich und gut lesbar. Das war früher in jeglicher Hinsicht anders.
Und ich finde, dass so ein Heft gerade in den Zeiten wichtig ist, in denen man jegliches Wissen aus dem Internet ziehen kann: In den ausführlichen Rezensionen und Artikeln kann ich Dinge in aller Ruhe nachlesen.
Leider sind nicht alle Beiträge richtig gut – damit war nicht zu rechnen. Der umfangreiche Artikel über die »Mark Brandis«-Serie ist extrem detailhuberisch, aber informativ und gut lesbar. Ob man allerdings unbedingt Romane rezensieren muss, die man als interessierter Kunde dann höchstens nur noch im Second-Hand-Handel bekommt, weiß ich nicht.
Bei einem solchen Umfang kann ich nicht alles gut finden. Lesenswert sind die umfangreichen Conberichte, interessant sind auch Berichte über aktuelle Computerspiele oder Rezensionen zu englischsprachiger Science Fiction. Gelesen habe ich nicht alles, dazu fehlen dann doch die Zeit und manchmal das Interesse.
Darum geht es nicht! Dieses Fanzine ist mehr eine Bestandsaufnahme der aktuellen Science Fiction, und diese ist notgedrungen sowohl lückenhaft als auch subjektiv geprägt. Wenn man das als Leser berücksichtigt, hat man ein gelungenes Heft vor sich, das den Science-Fiction-Club Deutschland e.V. definitiv schmückt.
Um es klar zu sagen: Es gibt derzeit wenige Science-Fiction-Magazine im deutschsprachigen Raum. Derzeit sind die »Andromeda Nachrichten« in diesem bescheidenen Reigen ein lesenswertes Fan-Magazin – finde ich gut!
 Die nun vorliegende Ausgabe 267 ist unfassbare 216 Seiten dick, im A4-Format, und das Layout sieht bei alledem auch noch sehr ordentlich aus, vielleicht ein wenig langweilig, aber stets übersichtlich und gut lesbar. Das war früher in jeglicher Hinsicht anders.
Die nun vorliegende Ausgabe 267 ist unfassbare 216 Seiten dick, im A4-Format, und das Layout sieht bei alledem auch noch sehr ordentlich aus, vielleicht ein wenig langweilig, aber stets übersichtlich und gut lesbar. Das war früher in jeglicher Hinsicht anders.Und ich finde, dass so ein Heft gerade in den Zeiten wichtig ist, in denen man jegliches Wissen aus dem Internet ziehen kann: In den ausführlichen Rezensionen und Artikeln kann ich Dinge in aller Ruhe nachlesen.
Leider sind nicht alle Beiträge richtig gut – damit war nicht zu rechnen. Der umfangreiche Artikel über die »Mark Brandis«-Serie ist extrem detailhuberisch, aber informativ und gut lesbar. Ob man allerdings unbedingt Romane rezensieren muss, die man als interessierter Kunde dann höchstens nur noch im Second-Hand-Handel bekommt, weiß ich nicht.
Bei einem solchen Umfang kann ich nicht alles gut finden. Lesenswert sind die umfangreichen Conberichte, interessant sind auch Berichte über aktuelle Computerspiele oder Rezensionen zu englischsprachiger Science Fiction. Gelesen habe ich nicht alles, dazu fehlen dann doch die Zeit und manchmal das Interesse.
Darum geht es nicht! Dieses Fanzine ist mehr eine Bestandsaufnahme der aktuellen Science Fiction, und diese ist notgedrungen sowohl lückenhaft als auch subjektiv geprägt. Wenn man das als Leser berücksichtigt, hat man ein gelungenes Heft vor sich, das den Science-Fiction-Club Deutschland e.V. definitiv schmückt.
Um es klar zu sagen: Es gibt derzeit wenige Science-Fiction-Magazine im deutschsprachigen Raum. Derzeit sind die »Andromeda Nachrichten« in diesem bescheidenen Reigen ein lesenswertes Fan-Magazin – finde ich gut!
04 Dezember 2019
Die Links-Rechts-Falle
In vielen aktuellen Diskussionen stelle ich fest, wie sehr sich die Maßstäbe verschoben haben. Wenn dem neuen Führungs-Duo der Sozialdemokraten allen Ernstes unterstellt wird, seine zwei Angehörigen seien »links«, und während allerlei Journalisten ebenso ernsthaft behaupten, die Republik sei »nach links gerutscht«, kann ich mir nur ans Hirn fassen.
Die Republik ist, wenn man schon bei diesen heute kaum noch stimmenden Begriffen bleibt, sowohl nach links als auch nach rechts gerutscht.
Wer durch das Grundgesetz begründete Dinge, die etwa für eine Gleichstellung von Lesben und Schwulen mit Heteros sorgen, für »links« hält, kann natürlich von einem »Linksrutsch« des Landes reden. Wer alle Versuche, weitere Schritte in Richtung Gleichberechtigung für Frauen zu erreichen, als »links« betrachtet, für den leben wir offenbar schon in einer Räterepublik oder im Früh-Sozialismus.
Wer Windräder als »links« betrachtet, einen »Veggie-Day« pro Woche auf freiwilliger Basis als Bestandteil einer Verbotskultur ansieht und in jeder selbstbewussten Frau ein Zeichen für die Unterdrückung von Männern sieht, wird womöglich ein Problem mit der aktuellen Kultur haben. Ähnliches gilt für Menschen, die es als Reduktion ihrer Rechte betrachten, wenn sie nicht mehr rassistische Begriffe benutzen sollen.
Man könnte sagen, die Republik sei mehr in Richtung Gleichberechtigung gegangen. Ob man das unbedingt als »links« bezeichnen muss, weiß ich nicht. Zum Ausgleich ist das Land nämlich wirtschaftspolitisch nach rechts gerutscht – in einer Weise, die mich heute schwindeln lässt.
In den 80er-Jahren wurde für die 35-Stunden-Woche gekämpft; heute sind unbezahlte Praktika für junge Leute, eine irrsinnige Leiharbeit-Szene und eine 40-plus-Stunden-Woche völlig normal. In zahllosen Betrieben gibt es keine Betriebsräte mehr. Die Steuerlast für die untere Hälfte der Bevölkerung ist gestiegen, während die reiche Oberschicht immer weiter entlastet wird. »Hartzer« sind in vielerlei Kreisen eine verspottete Unterschicht, während sich die sogenannte Mittelschicht lieber mit den Reichen solidarisiert.
Moderate Forderungen nach Steuererhöhungen, um beispielsweise in die Nähe der unter Helmut Kohl geltenden Steuern für Reiche zu kommen, werden mit massivem Druck abgelehnt. Um es klar zu sagen: Was unter Helmut Kohl in den 80er-Jahren als christdemokratische Wirtschaftspolitik galt, würde man heute als linksradikal geißeln.
Wir leben wirklich in seltsamen Zeiten. Aber in anderer Art und Weise, als uns suggeriert wird.
Die Republik ist, wenn man schon bei diesen heute kaum noch stimmenden Begriffen bleibt, sowohl nach links als auch nach rechts gerutscht.
Wer durch das Grundgesetz begründete Dinge, die etwa für eine Gleichstellung von Lesben und Schwulen mit Heteros sorgen, für »links« hält, kann natürlich von einem »Linksrutsch« des Landes reden. Wer alle Versuche, weitere Schritte in Richtung Gleichberechtigung für Frauen zu erreichen, als »links« betrachtet, für den leben wir offenbar schon in einer Räterepublik oder im Früh-Sozialismus.
Wer Windräder als »links« betrachtet, einen »Veggie-Day« pro Woche auf freiwilliger Basis als Bestandteil einer Verbotskultur ansieht und in jeder selbstbewussten Frau ein Zeichen für die Unterdrückung von Männern sieht, wird womöglich ein Problem mit der aktuellen Kultur haben. Ähnliches gilt für Menschen, die es als Reduktion ihrer Rechte betrachten, wenn sie nicht mehr rassistische Begriffe benutzen sollen.
Man könnte sagen, die Republik sei mehr in Richtung Gleichberechtigung gegangen. Ob man das unbedingt als »links« bezeichnen muss, weiß ich nicht. Zum Ausgleich ist das Land nämlich wirtschaftspolitisch nach rechts gerutscht – in einer Weise, die mich heute schwindeln lässt.
In den 80er-Jahren wurde für die 35-Stunden-Woche gekämpft; heute sind unbezahlte Praktika für junge Leute, eine irrsinnige Leiharbeit-Szene und eine 40-plus-Stunden-Woche völlig normal. In zahllosen Betrieben gibt es keine Betriebsräte mehr. Die Steuerlast für die untere Hälfte der Bevölkerung ist gestiegen, während die reiche Oberschicht immer weiter entlastet wird. »Hartzer« sind in vielerlei Kreisen eine verspottete Unterschicht, während sich die sogenannte Mittelschicht lieber mit den Reichen solidarisiert.
Moderate Forderungen nach Steuererhöhungen, um beispielsweise in die Nähe der unter Helmut Kohl geltenden Steuern für Reiche zu kommen, werden mit massivem Druck abgelehnt. Um es klar zu sagen: Was unter Helmut Kohl in den 80er-Jahren als christdemokratische Wirtschaftspolitik galt, würde man heute als linksradikal geißeln.
Wir leben wirklich in seltsamen Zeiten. Aber in anderer Art und Weise, als uns suggeriert wird.
03 Dezember 2019
Krimis, verwirrend und leicht depressiv
Ich habe schon gelegentlich auf die Comicserie »Jessica Blandy« verwiesen. Sie startete in den späten 80er-Jahren, wurde hierzulande nie so richtig bekannt und liegt jetzt komplett in sieben dicken Sammelbänden beim Verlag Schreiber & Leser vor.
Ich las zuletzt den fünften Band der Gesamtausgabe, der mir wieder einmal sehr gut gefiel. Das etwas handlicher wirkende Kleinformat der Comicbücher finde ich sehr praktisch; die Bücher liegen gut in der Hand, und die kleineren Seiten schaden der Geschichte nicht. Ganz im Gegenteil: Die eher ruhigen Bilder kommen besser zur Geltung, und die teilweise krassen Geschichten werden so noch klarer.
Der Band fasst vier Abenteuer zusammen, die zuvor als Alben veröffentlicht worden sind. Die Geschichte »Kuba« erweist sich beispielsweise als ein verwirrender Agenten-Thriller, der auf Kuba spielt und in dem sich verschiedene Gruppierungen von Agenten bekämpfen. Das geht natürlich nicht ohne mehrere Leichen ab.
In »Ginny« wird die Obsession für eine tote Frau für verschiedene Männer – und letztlich auch für Jessica Blandy – immer intensiver. In dieser Geschichte vermengen sich Elemente des Psychothrillers mit denen eines konventionellen Krimis.
Bei »Bussard« geht es um einen alten Musiker und seine tief verborgenen Geheimnisse. Bekanntlich kommt immer etwas zum Vorschein, wenn man zu tief bohrt ... so auch in diesem Fall.
In »Ich bin ein Killer« schließt sich der Kreis zu den anderen Fällen. In einer Therapieanstalt für besonders schwere Fälle trifft die Detektivin und Schriftstellerin auf einen Mann, den sie jagt und der sie töten will. Das könnte ich mir auch gut in einer Verfilmung vorstellen.
Der fünfte Band der »Jessica Blandy«-Gesamtausgabe ist vergleichsweise normal. Die Abgründe, in die Jean Dufaux und Renaud normalerweise die attraktive Hauptfigur schicken, sind diesmal nicht ganz so tief wie in anderen Fällen. Spannende Comic-Unterhaltung mit einer zurückhaltenden, aber stets gelungenen Optik bietet der Band aber jederzeit!
(Wer's nicht glaubt, checke die Leseprobe. Man findet sie auf der Internet-Seite des Verlags Schreiber & Leser.)
Ich las zuletzt den fünften Band der Gesamtausgabe, der mir wieder einmal sehr gut gefiel. Das etwas handlicher wirkende Kleinformat der Comicbücher finde ich sehr praktisch; die Bücher liegen gut in der Hand, und die kleineren Seiten schaden der Geschichte nicht. Ganz im Gegenteil: Die eher ruhigen Bilder kommen besser zur Geltung, und die teilweise krassen Geschichten werden so noch klarer.
Der Band fasst vier Abenteuer zusammen, die zuvor als Alben veröffentlicht worden sind. Die Geschichte »Kuba« erweist sich beispielsweise als ein verwirrender Agenten-Thriller, der auf Kuba spielt und in dem sich verschiedene Gruppierungen von Agenten bekämpfen. Das geht natürlich nicht ohne mehrere Leichen ab.
In »Ginny« wird die Obsession für eine tote Frau für verschiedene Männer – und letztlich auch für Jessica Blandy – immer intensiver. In dieser Geschichte vermengen sich Elemente des Psychothrillers mit denen eines konventionellen Krimis.
Bei »Bussard« geht es um einen alten Musiker und seine tief verborgenen Geheimnisse. Bekanntlich kommt immer etwas zum Vorschein, wenn man zu tief bohrt ... so auch in diesem Fall.
In »Ich bin ein Killer« schließt sich der Kreis zu den anderen Fällen. In einer Therapieanstalt für besonders schwere Fälle trifft die Detektivin und Schriftstellerin auf einen Mann, den sie jagt und der sie töten will. Das könnte ich mir auch gut in einer Verfilmung vorstellen.
Der fünfte Band der »Jessica Blandy«-Gesamtausgabe ist vergleichsweise normal. Die Abgründe, in die Jean Dufaux und Renaud normalerweise die attraktive Hauptfigur schicken, sind diesmal nicht ganz so tief wie in anderen Fällen. Spannende Comic-Unterhaltung mit einer zurückhaltenden, aber stets gelungenen Optik bietet der Band aber jederzeit!
(Wer's nicht glaubt, checke die Leseprobe. Man findet sie auf der Internet-Seite des Verlags Schreiber & Leser.)
NH3 zum Zehnjährigen
Bei ihrem Auftritt in Karlsruhe im Herbst 2017 konnte mich die italienische Band NH3 durchaus überzeugen. Sieht man davon ab, dass man zu oft versuchte, das Publikum zu Mitmachaktionen zu bewegen, wurde vor allem ein dynamischer und schneller Mix aus Ska und Punk, politischen Aussagen und viel Gezappel auf der Bühne präsentiert.
Die Platte »united we stand«, die 2012 aufgenommen wurde, spiegelt das gut wieder. Auf der EP, die zum zehnjährigen Bestehen der Band herauskam, sind vier Stücke, bei denen sie sich teilweise von Gastmusikern helfen ließ. Drei der Stücke sind Eigenkompositionen, mit »Police On My Back« gibt's aber auch eine Coverversion von The Clash.
Was die Band live bietet, liefert sie ebenso auf Platte – und andersrum. Die Texte wirken, sofern ich das Italienische nachvollziehen kann, stets politisch und »auf der richtigen Seite«, ohne dabei einen sauertöpfischen Charakter zu erhalten; die Musik ist dynamisch und flott – so etwas mag ich.
Wenn die Revolution je tanzen sollte, dann bitteschön mit NH3.
Die Platte »united we stand«, die 2012 aufgenommen wurde, spiegelt das gut wieder. Auf der EP, die zum zehnjährigen Bestehen der Band herauskam, sind vier Stücke, bei denen sie sich teilweise von Gastmusikern helfen ließ. Drei der Stücke sind Eigenkompositionen, mit »Police On My Back« gibt's aber auch eine Coverversion von The Clash.
Was die Band live bietet, liefert sie ebenso auf Platte – und andersrum. Die Texte wirken, sofern ich das Italienische nachvollziehen kann, stets politisch und »auf der richtigen Seite«, ohne dabei einen sauertöpfischen Charakter zu erhalten; die Musik ist dynamisch und flott – so etwas mag ich.
Wenn die Revolution je tanzen sollte, dann bitteschön mit NH3.
02 Dezember 2019
Verlags- und Autoren-Hickhack
Mit vor Staunen offenstehendem Mund habe ich übers Wochenende gelesen, wie sich in einer Facebook-Gruppe – also im öffentlichen Raum – der Konflikt zwischen einem Autor und einem Verleger hochgeschaukelt hat. Beide Personen sind mir seit Jahrzehnten bekannt; der Streit berührte persönliche und grundsätzliche Themen. Es ging um das liebe Geld, aber auch um Vertrauen und Freundschaft.
Ich könnte mich zurücklehnen und sagen, das gehe mich nichts an. Ich könnte mich einmischen und selbst eifrig kommentieren. Da ich beide Personen kenne, wäre das leicht möglich. Dass es sich bei dem Verlag um einen Kleinverlag handelt, ändert nichts daran, dass Bücher veröffentlicht worden sind. Es handelt sich um einen grundsätzlichen Streit, der an die Öffentlichkeit geraten ist.
Nur wäre es spannend, was wirklich vorgefallen ist. Wer hat recht? Welche Rechte werden angesprochen, welche werden oder wurden vielleicht verletzt? Gibt es Absprachen oder Diskussionen, die man nachvollziehen kann?
Ich stelle wieder einmal fest: Was angesichts solcher Konflikte fehlt, ist doch ein Medium, dass solche Themen sinnvoll aufbereitet. (So etwas wie der »Fandom Observer« in den letzten Jahren seiner Existenz.)
Es müsste nicht unbedingt ein gedrucktes Magazin sein, schon klar. Aber es wäre hilfreich, wenn es einen »zentralen Ort« gäbe – gedruckt oder digital, fast schon egal –, an dem mancher Konflikt und manches Thema in journalistischer Weise präsentiert würden: für interessierte Leser wie mich und vielleicht sogar für die Nachwelt.
Ich könnte mich zurücklehnen und sagen, das gehe mich nichts an. Ich könnte mich einmischen und selbst eifrig kommentieren. Da ich beide Personen kenne, wäre das leicht möglich. Dass es sich bei dem Verlag um einen Kleinverlag handelt, ändert nichts daran, dass Bücher veröffentlicht worden sind. Es handelt sich um einen grundsätzlichen Streit, der an die Öffentlichkeit geraten ist.
Nur wäre es spannend, was wirklich vorgefallen ist. Wer hat recht? Welche Rechte werden angesprochen, welche werden oder wurden vielleicht verletzt? Gibt es Absprachen oder Diskussionen, die man nachvollziehen kann?
Ich stelle wieder einmal fest: Was angesichts solcher Konflikte fehlt, ist doch ein Medium, dass solche Themen sinnvoll aufbereitet. (So etwas wie der »Fandom Observer« in den letzten Jahren seiner Existenz.)
Es müsste nicht unbedingt ein gedrucktes Magazin sein, schon klar. Aber es wäre hilfreich, wenn es einen »zentralen Ort« gäbe – gedruckt oder digital, fast schon egal –, an dem mancher Konflikt und manches Thema in journalistischer Weise präsentiert würden: für interessierte Leser wie mich und vielleicht sogar für die Nachwelt.
29 November 2019
Sternzeichen-Gläubige
»Herr Frick, welches Sternzeichen haben Sie eigentlich?« Die Frage klang nett, sie war auch nett gemeint, und ich wusste, dass die Person, die sie mir stellte, nicht bösartig war.
Mein Problem ist, dass ich Sternzeichen und alle damit zusammenhängenden Erwägungen blöd finde. Wer sich das nicht vorstellen kann, möge im Internet nach der Definition von »Hokuspokus« oder »Unfug« suchen.
»Ich bin Steinbock«, reagierte ich geistesgegenwärtig und ganz freundlich.
Die andere Person war davon positiv angetan. »Das merkt man gleich. Sie sind immer so diszipliniert, Sie bleiben immer bodenständig, und was Sie sich vornehmen, das setzen Sie auch um.«
Ich nickte beifällig. Der Mann, der neben mir saß, stieß mich an. »Dann bin ich auch Steinbock, oder?« Sein Geburtstag lag fünf Tage nach dem meinen. Ich hoffte, dass er in dieser Lage die Klappe hielt.
»Na klar.« Ich nickte. »Du hast logischerweise dasselbe Sternzeichen wie ich.«
»Auch das passt.« Die Person war begeistert. »Das kann man über Sie ja auch alles sagen.«
Es ging noch eine Weile so weiter. Es war nicht das erste Mal, dass ich diesen blöden Witz angewandt hatte. Ich hatte mich auch schon als Jungfrau oder Wassermann ausgegeben, und die Horoskop-Gläubigen hatten mir das geglaubt, waren komplett sicher gewesen, dass die Charaktereigenschaften stimmten.
Aber wer glaubt, der soll gerne weiterglauben. Ich bin nicht auf dieser Welt, um die Glaubensgebilde von anderen Menschen einstürzen zu lassen.
Mein Problem ist, dass ich Sternzeichen und alle damit zusammenhängenden Erwägungen blöd finde. Wer sich das nicht vorstellen kann, möge im Internet nach der Definition von »Hokuspokus« oder »Unfug« suchen.
»Ich bin Steinbock«, reagierte ich geistesgegenwärtig und ganz freundlich.
Die andere Person war davon positiv angetan. »Das merkt man gleich. Sie sind immer so diszipliniert, Sie bleiben immer bodenständig, und was Sie sich vornehmen, das setzen Sie auch um.«
Ich nickte beifällig. Der Mann, der neben mir saß, stieß mich an. »Dann bin ich auch Steinbock, oder?« Sein Geburtstag lag fünf Tage nach dem meinen. Ich hoffte, dass er in dieser Lage die Klappe hielt.
»Na klar.« Ich nickte. »Du hast logischerweise dasselbe Sternzeichen wie ich.«
»Auch das passt.« Die Person war begeistert. »Das kann man über Sie ja auch alles sagen.«
Es ging noch eine Weile so weiter. Es war nicht das erste Mal, dass ich diesen blöden Witz angewandt hatte. Ich hatte mich auch schon als Jungfrau oder Wassermann ausgegeben, und die Horoskop-Gläubigen hatten mir das geglaubt, waren komplett sicher gewesen, dass die Charaktereigenschaften stimmten.
Aber wer glaubt, der soll gerne weiterglauben. Ich bin nicht auf dieser Welt, um die Glaubensgebilde von anderen Menschen einstürzen zu lassen.
Literatur-Termin in Karlsruhe
Ich kann ja nicht hin, aber den Termin möchte ich allen empfehlen, die sich für Literatur interessieren und die aus dem Großraum Karlsruhe kommen. Am Dienstag, 3. Dezember, gibt es ein offenes Seminar mit der Zeitschrift »Autorenwelt«; eingeladen dazu wird von der Literatenrunde Karlsruhe e.V.
Es referiert Sandra Uschtrin, die seit vielen Jahren mit ihren Verlag für Autorinnen und Autoren arbeitet. Sie gibt ein lesenswertes Handbuch für Autorinnen und Autoren heraus, in ihrem Verlag erscheinen die Zeitschriften »Federwelt« und »Selfpublisher«, und mit der »Autorenwelt« hat sie eine Plattform geschaffen, bei der Autorinnen und Autoren – zumindest theoretisch – auch finanziell profitieren sollen.
Sie hat auch mal ein Interview mit mir geführt, wir haben uns schon unterhalten, aber ich glaube nicht, dass sie noch weiß, wer ich bin. Ihre Arbeit schätze ich sehr – und sie hat sicher viele interessante Dinge zu berichten und zu erzählen.
Was genau bei diesem Seminar passiert, weiß ich nicht; der Eintritt ist frei. Es wäre natürlich nett, wenn man sich vorher per Mail oder über die Internet-Seite anmelden würde (damit die Veranstalter wissen, wie viele Leute kommen). Beginn ist um 18 Uhr – alles andere steht auf der Website.
Es referiert Sandra Uschtrin, die seit vielen Jahren mit ihren Verlag für Autorinnen und Autoren arbeitet. Sie gibt ein lesenswertes Handbuch für Autorinnen und Autoren heraus, in ihrem Verlag erscheinen die Zeitschriften »Federwelt« und »Selfpublisher«, und mit der »Autorenwelt« hat sie eine Plattform geschaffen, bei der Autorinnen und Autoren – zumindest theoretisch – auch finanziell profitieren sollen.
Sie hat auch mal ein Interview mit mir geführt, wir haben uns schon unterhalten, aber ich glaube nicht, dass sie noch weiß, wer ich bin. Ihre Arbeit schätze ich sehr – und sie hat sicher viele interessante Dinge zu berichten und zu erzählen.
Was genau bei diesem Seminar passiert, weiß ich nicht; der Eintritt ist frei. Es wäre natürlich nett, wenn man sich vorher per Mail oder über die Internet-Seite anmelden würde (damit die Veranstalter wissen, wie viele Leute kommen). Beginn ist um 18 Uhr – alles andere steht auf der Website.
28 November 2019
Auf den November 2009 geschaut
Ab und zu blicke ich in meinem Blog bewusst in die Vergangenheit. Das sollte ich nicht zu oft tun, ich weiß – aber heute nahm ich mir mal die Blogtexte aus dem November 2009 vor. Das ist zehn Jahre her, und man könnte meinen, es habe sich in mancherlei Hinsicht nichts geändert.
In dem Text »Immer noch 2001« schrieb ich am 14. November 2009 über den Buch- und Schallplattenversand »Zweitausendeins«, der vor zehn Jahren seinen vierzigsten Geburtstag feierte, dieser Tage also seinen fünfzigsten zu feiern hätte. Für mich war der Versandhandel jahrelang sehr wichtig: Ich wohnte in einem Dorf, und die Kleinstadt hatte Buchhandlungen, in denen man scheel angeguckt wurde, wenn man Trivialliteratur bestellte. Also bestellte ich onli..., ähm, über einen Katalog und Postkarten, auf die ich die Bestellungen kritzelte.
Unter »2012 geguckt« ging es am 13. November um den Science-Fiction-Streifen »2012« von Ronald Emmerich, den ich trotz aller Schwächen sehr unterhaltsam fand: Krachbummbeng vom Feinsten eben, mit viel Action und knalligen Bildern. Das Jahr 2012 ging übrigens vorüber, und die legendäre Maya-Prophezeiung hat mittlerweile fast jeder vergessen.
»Trubel in der Blogosphäre« am 11. November ... Damals war das Bloggen noch relativ neu, und es gab sogenannte Alpha-Blogger, die man besonders wichtig nahm und die überall zitiert wurden. Mit dem Abstand von zehn Jahren kommen mir die Diskussionen noch absurder vor als damals.
Ich war in diesem Monat sogar in der Oper. In »Don Carlos und ich« schrieb ich über eine moderne Aufführung im Theater in Karlsruhe, die mich faszinierte. Verblüfft stelle ich fest, an wie viele Details aus der Oper ich mich heute noch erinnere: nicht die Musik, sondern die Optik und die Stimmung. Offenbar blieb einiges im Kopf hängen.
Am 1. November schrieb ich übrigens über ein Punk-Konzert, eher Hardcore, aber das ist nach all den Jahren auch nicht mehr so wichtig. »Doom und Hardcore und verrückte Affen« ist ein Konzertbericht betitelt. Und hier versagt meine Erinnerung mittlerweile fast vollständig.
In dem Text »Immer noch 2001« schrieb ich am 14. November 2009 über den Buch- und Schallplattenversand »Zweitausendeins«, der vor zehn Jahren seinen vierzigsten Geburtstag feierte, dieser Tage also seinen fünfzigsten zu feiern hätte. Für mich war der Versandhandel jahrelang sehr wichtig: Ich wohnte in einem Dorf, und die Kleinstadt hatte Buchhandlungen, in denen man scheel angeguckt wurde, wenn man Trivialliteratur bestellte. Also bestellte ich onli..., ähm, über einen Katalog und Postkarten, auf die ich die Bestellungen kritzelte.
Unter »2012 geguckt« ging es am 13. November um den Science-Fiction-Streifen »2012« von Ronald Emmerich, den ich trotz aller Schwächen sehr unterhaltsam fand: Krachbummbeng vom Feinsten eben, mit viel Action und knalligen Bildern. Das Jahr 2012 ging übrigens vorüber, und die legendäre Maya-Prophezeiung hat mittlerweile fast jeder vergessen.
»Trubel in der Blogosphäre« am 11. November ... Damals war das Bloggen noch relativ neu, und es gab sogenannte Alpha-Blogger, die man besonders wichtig nahm und die überall zitiert wurden. Mit dem Abstand von zehn Jahren kommen mir die Diskussionen noch absurder vor als damals.
Ich war in diesem Monat sogar in der Oper. In »Don Carlos und ich« schrieb ich über eine moderne Aufführung im Theater in Karlsruhe, die mich faszinierte. Verblüfft stelle ich fest, an wie viele Details aus der Oper ich mich heute noch erinnere: nicht die Musik, sondern die Optik und die Stimmung. Offenbar blieb einiges im Kopf hängen.
Am 1. November schrieb ich übrigens über ein Punk-Konzert, eher Hardcore, aber das ist nach all den Jahren auch nicht mehr so wichtig. »Doom und Hardcore und verrückte Affen« ist ein Konzertbericht betitelt. Und hier versagt meine Erinnerung mittlerweile fast vollständig.
27 November 2019
Wüstes Geboller aus L.A. und Moskau
Es gibt immer noch Bands, die mich verblüffen können. Eine davon sind die Svetlanas, bei denen ich mir relativ lang nicht sicher war, ob es sich da nicht um eine Satire handeln könnte.
Da bollert das Schlagzeug im Spät-80er-Jahre-Doublebass-Stil, da wettern die Hardrock- und Metal-Riffs der Gitarre, dazu brüllt und schreibt die Sängerin in derbem Stil. Selten habe ich so eine rotzige Hardrock- oder Metal-Scheibe gehört, was aber auch daher kommt, dass ich den Stil normalerweise meide.
Die Svetlanas sind – so das Band-Info – eine aus Moskau stammende Sängerin oder eher Brüllerin, die mittlerweile in Los Angeles wohnt und sich dort eine aus vier Männern bestehende Band zusammengebastelt hat. Die wiederum haben einschlägige Erfahrung aus diversen Bands aus dem krachigen Sektor, was man durchaus hören kann.
Das hat manchmal einen leichten Punk- oder Hardcore-Anteil, ist ansonsten aber beinharter Metal oder Hardrock. Bei Stücken wie »Speed Freak«, das sich ausdrücklich als eine Hommage an Motörhead versteht, wird die Gitarre in rasendem Tempo gespielt; so was habe ich freiwillig wirklich zuletzt in den 80er-Jahren gehört.
Dazu die Texte: »Putin On Da Hitz« oder »Where Is My Borscht« sind durchaus witzig; ansonsten werden Metaller-Klischees wie »Let's Get Drunk« oder »Vodka'n'Roll« bedient. Das ist nicht gerade originell, wird aber durchaus witzig, weil die Sängerin einen derben Akzent hat und die Texte extrem schlicht sind.
Sagen wir so: Das kann man sich durchaus antun, das hat auch was, und ich bin sicher, dass jüngere Metal-Fans darauf komplett abfahren würden. Mir ist es zu metallisch und auf die Dauer auch zu stumpf.
Da bollert das Schlagzeug im Spät-80er-Jahre-Doublebass-Stil, da wettern die Hardrock- und Metal-Riffs der Gitarre, dazu brüllt und schreibt die Sängerin in derbem Stil. Selten habe ich so eine rotzige Hardrock- oder Metal-Scheibe gehört, was aber auch daher kommt, dass ich den Stil normalerweise meide.
Die Svetlanas sind – so das Band-Info – eine aus Moskau stammende Sängerin oder eher Brüllerin, die mittlerweile in Los Angeles wohnt und sich dort eine aus vier Männern bestehende Band zusammengebastelt hat. Die wiederum haben einschlägige Erfahrung aus diversen Bands aus dem krachigen Sektor, was man durchaus hören kann.
Das hat manchmal einen leichten Punk- oder Hardcore-Anteil, ist ansonsten aber beinharter Metal oder Hardrock. Bei Stücken wie »Speed Freak«, das sich ausdrücklich als eine Hommage an Motörhead versteht, wird die Gitarre in rasendem Tempo gespielt; so was habe ich freiwillig wirklich zuletzt in den 80er-Jahren gehört.
Dazu die Texte: »Putin On Da Hitz« oder »Where Is My Borscht« sind durchaus witzig; ansonsten werden Metaller-Klischees wie »Let's Get Drunk« oder »Vodka'n'Roll« bedient. Das ist nicht gerade originell, wird aber durchaus witzig, weil die Sängerin einen derben Akzent hat und die Texte extrem schlicht sind.
Sagen wir so: Das kann man sich durchaus antun, das hat auch was, und ich bin sicher, dass jüngere Metal-Fans darauf komplett abfahren würden. Mir ist es zu metallisch und auf die Dauer auch zu stumpf.
Krasser Krimi-Comic
In den USA erscheinen die neuen »James Bond«-Comics bei Dynamite, zuerst werden sie als Hefte publiziert. Hierzulande kommen sie als schicke Hardcover-Bände beim Splitter-Verlag heraus – übrigens in zwei verschiedenen Ausführungen, eine eher normale zu einem handelsüblichen Preis, und eine ergänzte, die teurer und auf 1007 Exemplare limitiert worden ist. Ich finde ja, dass sich beide lohnen ...
Nachdem ich schon vom ersten Band sehr begeistert war, ging ich mit großem Interesse auf den zweiten los. »Eidolon« ist eine völlig in sich abgeschlossene Story; sie spielt im »James Bond«-Universum, hat aber keine direkte Verbindung zum ersten Band.
Die Geschichte beginnt in Los Angeles, spielt aber allem in London und Umgebung. Eigentlich soll Bond nur eine Geheimdienst-Mitarbeiterin in Los Angeles abholen, aber sehr schnell wird klar, dass eine Reihe von Killern auf der Spur der jungen Frau ist. Diese Killer erweisen sich als aktive oder ehemalige Geheimdienstler.
Doch warum jagen sie eine junge Frau? Wenn Bond mehr herausfinden will, muss er auch zu brutalen Mitteln greifen. Entsprechend derb geht es im weiteren Verlauf der Story zu ...
Warren Ellis als Autor von »Eidolon« zieht alle Register. Es wird geschossen und gekämpft, Bomben explodieren, Genicke werden gebrochen, sogar Folter wird eingesetzt – und ein wenig Sex wird zumindest angedeutet. Die Geschichte ist knallig und richtig spannend, weil man sehr lange nicht weiß, wer eigentlich welche Ziele hat.
Jason Masters setzt die Geschichte in klare Bilder um; die Farbgebung durch Guy Major unterstreicht das auch noch. Die Innenstadt-Szenen in London und Los Angeles wirken sauber recherchiert, die Action-Szenen stecken voller Dynamik, ohne dass es moderne Effekte wie zu viele Speedlines gibt.
Alles in allem ist »Eidolon« echt klasse. Wenn man mal einen spannenden Thriller in Comic-Form lesen möchte, ist man mit dem Band bestens beraten. (Schaut euch die Leseprobe auf der Internet-Seite des Verlages an!). Ich freue mich schon auf den nächsten »James Bond«-Band.
Nachdem ich schon vom ersten Band sehr begeistert war, ging ich mit großem Interesse auf den zweiten los. »Eidolon« ist eine völlig in sich abgeschlossene Story; sie spielt im »James Bond«-Universum, hat aber keine direkte Verbindung zum ersten Band.
Die Geschichte beginnt in Los Angeles, spielt aber allem in London und Umgebung. Eigentlich soll Bond nur eine Geheimdienst-Mitarbeiterin in Los Angeles abholen, aber sehr schnell wird klar, dass eine Reihe von Killern auf der Spur der jungen Frau ist. Diese Killer erweisen sich als aktive oder ehemalige Geheimdienstler.
Doch warum jagen sie eine junge Frau? Wenn Bond mehr herausfinden will, muss er auch zu brutalen Mitteln greifen. Entsprechend derb geht es im weiteren Verlauf der Story zu ...
Warren Ellis als Autor von »Eidolon« zieht alle Register. Es wird geschossen und gekämpft, Bomben explodieren, Genicke werden gebrochen, sogar Folter wird eingesetzt – und ein wenig Sex wird zumindest angedeutet. Die Geschichte ist knallig und richtig spannend, weil man sehr lange nicht weiß, wer eigentlich welche Ziele hat.
Jason Masters setzt die Geschichte in klare Bilder um; die Farbgebung durch Guy Major unterstreicht das auch noch. Die Innenstadt-Szenen in London und Los Angeles wirken sauber recherchiert, die Action-Szenen stecken voller Dynamik, ohne dass es moderne Effekte wie zu viele Speedlines gibt.
Alles in allem ist »Eidolon« echt klasse. Wenn man mal einen spannenden Thriller in Comic-Form lesen möchte, ist man mit dem Band bestens beraten. (Schaut euch die Leseprobe auf der Internet-Seite des Verlages an!). Ich freue mich schon auf den nächsten »James Bond«-Band.
26 November 2019
Kurze Erinnerung an Uwe Luserke
Ich hatte ihn seit Jahren aus den Augen verloren und war entsprechend verblüfft, als ich es dieser Tage erst mitbekam: Der Science-Fiction-Fan, Literaturagent, Übersetzer und Herausgeber Uwe Luserke ist bereits am 22. November 2018 verstorben. Dabei hatte ich sowohl privat als auch beruflich einige Male mit ihm zu tun.
In den frühen 80er-Jahren zählte er zu meinen ersten Science-Fiction-Kontakten im Großraum Stuttgart. Er war Mitglied bei den Science-Fiction-Freunden Stuttgart, er war Chefredakteur der semiprofessionellen Zeitschrift »Solaris«, man traf sich bei Cons. Als aus meinem Fanzine SAGITTARIUS dank der engagierten Mithilfe von Günther Freunek und später Achim Reichrath – beide aus Renningen – ein semiprofessionelles Magazin wurde, erwies sich Uwe Luserke als freundlicher »älterer Freund«, der uns kostenlos Bilder von David A. Hardy zur Verfügung stellte.
Mit seiner Hilfe konnten wir in unserem Kleinverlag in der Mitte der 80er-Jahre sogar einen Kunstbildband veröffentlichen. Wenn ich mich düster erinnere, fuhren wir einmal sogar bei ihm vorbei; er wohnte in Gerlingen, in der Nähe von Stuttgart also. Im persönlichen Umgang war er stets kompetent und sympathisch; ein Science-Fiction-Fan mit professioneller Seite.
Nach dem Ende von SAGITTARIUS verlor ich Uwe Luserke aus den Augen. Ich hörte allerlei Gerüchte über ihn, hatte aber nichts mit ihm zu tun. In den späten 90er-Jahren war er für Weltbild als freier Mitarbeiter tätig; hier flossen seine Erfahrungen als Literaturagent, Übersetzer und Herausgeber ein. Und hier arbeiteten wir bei verschiedenen Buchreihen zusammen. Danach hatten wir wieder jahrelang keinen Kontakt mehr; ich dachte auch nicht mehr an ihn.
Uwe Luserke wurde 76 Jahre alt. Ich hätte ihn immer auf jünger geschätzt. In Erinnerung möchte ich ihn als freundlichen Science-Fiction-Experten behalten, von dem ich in den 80er-Jahren einiges lernte.
In den frühen 80er-Jahren zählte er zu meinen ersten Science-Fiction-Kontakten im Großraum Stuttgart. Er war Mitglied bei den Science-Fiction-Freunden Stuttgart, er war Chefredakteur der semiprofessionellen Zeitschrift »Solaris«, man traf sich bei Cons. Als aus meinem Fanzine SAGITTARIUS dank der engagierten Mithilfe von Günther Freunek und später Achim Reichrath – beide aus Renningen – ein semiprofessionelles Magazin wurde, erwies sich Uwe Luserke als freundlicher »älterer Freund«, der uns kostenlos Bilder von David A. Hardy zur Verfügung stellte.
Mit seiner Hilfe konnten wir in unserem Kleinverlag in der Mitte der 80er-Jahre sogar einen Kunstbildband veröffentlichen. Wenn ich mich düster erinnere, fuhren wir einmal sogar bei ihm vorbei; er wohnte in Gerlingen, in der Nähe von Stuttgart also. Im persönlichen Umgang war er stets kompetent und sympathisch; ein Science-Fiction-Fan mit professioneller Seite.
Nach dem Ende von SAGITTARIUS verlor ich Uwe Luserke aus den Augen. Ich hörte allerlei Gerüchte über ihn, hatte aber nichts mit ihm zu tun. In den späten 90er-Jahren war er für Weltbild als freier Mitarbeiter tätig; hier flossen seine Erfahrungen als Literaturagent, Übersetzer und Herausgeber ein. Und hier arbeiteten wir bei verschiedenen Buchreihen zusammen. Danach hatten wir wieder jahrelang keinen Kontakt mehr; ich dachte auch nicht mehr an ihn.
Uwe Luserke wurde 76 Jahre alt. Ich hätte ihn immer auf jünger geschätzt. In Erinnerung möchte ich ihn als freundlichen Science-Fiction-Experten behalten, von dem ich in den 80er-Jahren einiges lernte.
Abonnieren
Posts (Atom)