Ich weiß selbst, dass eine Graphic Novel nichts anderes ist als ein Comic – trotzdem hat sich dieser Begriff im Verlauf der vergangenen dreißig Jahren durchgesetzt. Auf der Internet-Seite der Raketenheftchenserie, für die ich arbeite, hatte ich zuletzt »eine Woche der Graphic Novels«, in der an jedem Tag ein starker Comic mit besonderem Thema vorgestellt wurde. Das möchte ich an dieser Stelle gern rekapitulieren ...
Unter dem Titel »Bedrückender Blick in Kriegsgefangenenlager« stellte ich den Band »Ich, René Tardi, Kriegsgefangener im Stalag II B« vor. Gezeichnet und geschrieben wurde er von dem französischen Comic-Star Jacques Tardi – es ist keine leichte Lektüre, aber sie lohnt sich.
Sehr mysteriös ist die Geschichte von »Appartement 23«, der Graphic Novel von Guillaume Sorel; der Zeichner und Autor steht schon immer für ausgefallene Geschichten. Meine Besprechung steht folgerichtig unter dem Titel »Zwischen Literatur, Traum und Comic«.
Ein französischer Zeichner, der hierzulande nicht sonderlich bekannt ist, begibt sich auf die Spuren seines Großvaters, der im Zweiten Weltkrieg in deutsche Gefangenschaft geriet – »Auf den Spuren Rogers« ist ein eindrucksvoller Comic-Roman. Meine Besprechung steht unter dem Titel »Der Vergangenheit hinterher«; die Geschichte ist kein Action-Kracher, entwickelt sich aber folgerichtig.
Auf der Perry-Seite habe ich den famosen Comic »Auf nach Matha« besprochen; dabei handelt es sich um einen melancholischen Blick in die 60er-Jahre, auf Popkultur der damaligen Zeit und die Jugendkultur von damals. Junge Leute am Strand, Stress mit den Eltern – das ist alles schön erzählt.
Der wohl bekannteste und eindrucksvollste Roman über den Ersten Weltkrieg ist »Im Westen nichts Neues« – den fand ich als gedruckten Roman schon hammerhart. Peter Eickmeyer machte daraus eine Graphic Novel, die sehr ruhig ist und bei der man tatsächlich kaum den Begriff »Comic« benutzen kann.
Alles in allem beweisen die fünf Bücher, dass Graphic Novels schon eine eigenständige Sache sind, meinetwegen eine Untergattung der Neunten Kunst, der Comics also. Es handelt sich bei den vorgestellten Büchern immer um Romane, die eben mit Bildern erzählt werden, durchaus literarisch und anspruchsvoll.
Es passiert einiges um mich herum, und nicht alles gefällt mir. Vieles fasziniert mich, vieles interessiert mich – und das soll Thema dieses Blogs sein.
30 April 2015
29 April 2015
Stressfrei gegen Pegidioten
Der Dienstag abend war kühl und frisch, zugleich sonnig. Eigentlich ein ideales Wetter, um einen gemütlichen Abend zu verbringen. Da aber in Karlsruhe die Pegida zu ihrem »Spaziergang« aufgerufen hatte, fühlte ich mich dazu gedrängt, zur Gegendemonstration zu gehen.
Leider war ich nicht so pünktlich unterwegs, wie ich das eigentlich geplant hatte. Als ich auf dem Stephansplatz eintraf, hatten die Pegidioten bereits mit ihrer Kundgebung begonnen. Wie immer war nicht viel zu sehen, weil die Polizei alles weiträumig abgeriegelt hatte.
Die »bürgerliche« Gegendemonstration bestand zu diesem Zeitpunkt aus vielleicht 300 Leuten. Aus den Boxen drang nette Musik, einige Leute tanzten sogar; ansonsten wurde mit Trillerpfeifen und Trommeln ordentlich Radau gemacht. Die Stimmung war recht gelassen, auch deshalb, weil die Polizei offenbar nicht auf Krawall gebürstet war.
Die einzige Auseinandersetzung an diesem Tag fand wohl an einer Straßenbahnhaltestelle statt. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und verletzte vor allem Unbeteiligte. Denn Sinn dieses Vorgehens mögen bitte andere Leute diskutieren ...
Mit meinem Rad fuhr ich ein wenig durch die Gegend. Von der »anderen Seite« her kam ich ein wenig näher an die Pegidioten heran. Das einzige, was ich vom Lautsprecher aus hörte, waren zwei Worte: Der Redner brüllte etwas von »abschieben« und »Deutschland«; diese beiden Worte kamen praktisch ununterbrochen an mein Ohr, alles andere ging im Lärm der Trillerpfeifen unter.
Ich begab mich in die Sophienstraße, an die Ecke zur Waldstraße. Dort sollte der Versuch unternommen werden, den angeblichien »Spaziergang« zu blockieren. Es waren vielleicht 150 Demonstranten, die von gut hundert Polizisten buchstäblich eingekreist waren. Die Stimmung war trotzdem locker; Musik lief, einige tanzten wieder. Und es kamen ständig neue Leute hinzu.
Als später der Aufmarsch der Pegidioten die Waldstraße hochzog, waren wir wohl um die 300 Leute. Parolen wurden gebrüllt, es wurde getrillert und getrommelt. Anwohner hängten ein riesiges »Gegen Nazis«-Transparent aus ihren Fenstern, unter dem die Pegida hindurchspazieren durfte.
Interessiert schaute ich dem Haufen der Pegidioten nach; nach meiner Schätzung waren es nicht mehr als 80 Leute, die von starken Polizeikräften eskortiert wurden. Als sie vorbei waren, begab ich mich mit den anderen Demonstranten zurück zum Stephansplatz.
Dort herrschte geruhsame Stimmung, bis die Pegida-Leute wieder auftauchten, um ihre Abschlusskundgebung abzuhalten. Unter gellenden Pfiffen und Sprechchören hielten die Redner ihren Vortrag; ich verstand kein Wort. Später begab ich mich mit anderen Leuten an eine andere Stelle des Platzes, direkt vor das Lokal am Eingang zur Postgalerie.
Dutzende von Leuten kletterten auf die Tische und Stühle. Verzweifelt versuchte eine junge Restaurantangestellte, die Demonstranten davon abzuhalten; es war vergeblich. Wer auf einem Tisch stand, konnte zumindest besser zur Pegida hinüberbrüllen.
Und da war es richtig witzig. Die Sprechchöre waren abwechslungsreich, die Demonstranten waren bester Laune, es wurde auch gelacht. Die Polizei setzte zwischendurch mal die Helme auf, was sie sofort martialisch machte, dann wieder ab – unterm Strich blieb aber alles sehr friedlich.
Nach 21 Uhr war der Spuk endlich vorüber. Die Pegida-Leute wurden zum Bahnhof gekarrt, die Antifa zog in einer Spontan-Demonstration quer durch die Stadt in Richtung Südstadt. Und ich machte, dass ich heimkam: Ich wollte das Pokal-Halbfinalspiel zwischen Dortmund und München zumindest noch teilweise angucken – das wurde dann ein spannender Abschluss eines friedlichen Abends.
Leider war ich nicht so pünktlich unterwegs, wie ich das eigentlich geplant hatte. Als ich auf dem Stephansplatz eintraf, hatten die Pegidioten bereits mit ihrer Kundgebung begonnen. Wie immer war nicht viel zu sehen, weil die Polizei alles weiträumig abgeriegelt hatte.
Die »bürgerliche« Gegendemonstration bestand zu diesem Zeitpunkt aus vielleicht 300 Leuten. Aus den Boxen drang nette Musik, einige Leute tanzten sogar; ansonsten wurde mit Trillerpfeifen und Trommeln ordentlich Radau gemacht. Die Stimmung war recht gelassen, auch deshalb, weil die Polizei offenbar nicht auf Krawall gebürstet war.
Die einzige Auseinandersetzung an diesem Tag fand wohl an einer Straßenbahnhaltestelle statt. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und verletzte vor allem Unbeteiligte. Denn Sinn dieses Vorgehens mögen bitte andere Leute diskutieren ...
Mit meinem Rad fuhr ich ein wenig durch die Gegend. Von der »anderen Seite« her kam ich ein wenig näher an die Pegidioten heran. Das einzige, was ich vom Lautsprecher aus hörte, waren zwei Worte: Der Redner brüllte etwas von »abschieben« und »Deutschland«; diese beiden Worte kamen praktisch ununterbrochen an mein Ohr, alles andere ging im Lärm der Trillerpfeifen unter.
Ich begab mich in die Sophienstraße, an die Ecke zur Waldstraße. Dort sollte der Versuch unternommen werden, den angeblichien »Spaziergang« zu blockieren. Es waren vielleicht 150 Demonstranten, die von gut hundert Polizisten buchstäblich eingekreist waren. Die Stimmung war trotzdem locker; Musik lief, einige tanzten wieder. Und es kamen ständig neue Leute hinzu.
Als später der Aufmarsch der Pegidioten die Waldstraße hochzog, waren wir wohl um die 300 Leute. Parolen wurden gebrüllt, es wurde getrillert und getrommelt. Anwohner hängten ein riesiges »Gegen Nazis«-Transparent aus ihren Fenstern, unter dem die Pegida hindurchspazieren durfte.
Interessiert schaute ich dem Haufen der Pegidioten nach; nach meiner Schätzung waren es nicht mehr als 80 Leute, die von starken Polizeikräften eskortiert wurden. Als sie vorbei waren, begab ich mich mit den anderen Demonstranten zurück zum Stephansplatz.
Dort herrschte geruhsame Stimmung, bis die Pegida-Leute wieder auftauchten, um ihre Abschlusskundgebung abzuhalten. Unter gellenden Pfiffen und Sprechchören hielten die Redner ihren Vortrag; ich verstand kein Wort. Später begab ich mich mit anderen Leuten an eine andere Stelle des Platzes, direkt vor das Lokal am Eingang zur Postgalerie.
Dutzende von Leuten kletterten auf die Tische und Stühle. Verzweifelt versuchte eine junge Restaurantangestellte, die Demonstranten davon abzuhalten; es war vergeblich. Wer auf einem Tisch stand, konnte zumindest besser zur Pegida hinüberbrüllen.
Und da war es richtig witzig. Die Sprechchöre waren abwechslungsreich, die Demonstranten waren bester Laune, es wurde auch gelacht. Die Polizei setzte zwischendurch mal die Helme auf, was sie sofort martialisch machte, dann wieder ab – unterm Strich blieb aber alles sehr friedlich.
Nach 21 Uhr war der Spuk endlich vorüber. Die Pegida-Leute wurden zum Bahnhof gekarrt, die Antifa zog in einer Spontan-Demonstration quer durch die Stadt in Richtung Südstadt. Und ich machte, dass ich heimkam: Ich wollte das Pokal-Halbfinalspiel zwischen Dortmund und München zumindest noch teilweise angucken – das wurde dann ein spannender Abschluss eines friedlichen Abends.
Konkrete Erinnerungen, musikalisch
Es gibt immer wieder Bands, mit denen ich so gar nicht gerechnet habe. Ein Beispiel dafür ist Much Better Thank You, eine Band, die aus der Gegend von Osnabrück kommt und sich musikalisch zwischen diverse Schubladen setzt.
Ich habe die CD »Concrete Memories« gehört, die auf den siebzigsten Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz anspielt. Auf der CD sind nur zwei Stücke enthalten, doch die haben es in sich; vor allem fällt die Stimme der Sängerin extrem auf.
Die Stimme ist dünn und hoch, aber dennoch ausdrucksstark. Sie vibriert manchmal, sie piepst und sie ist filigran. Wer mag, darf den Vergleich mit einer Elfe aus der Klischee-Schublade ziehen, möge aber bitte die Unter-Schublade mit Björk stecken lassen – das passt ebenso wenig wie Kate Bush. Das ist alles schon eigenständig, beim ersten Ton dadurch nicht eingängig, dann aber doch immer klarer und auch gelungener.
Die Musik ist die meiste Zeit zurückhaltend, gleichzeitig sehr vielseitig: Im Stück gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, und manchmal wechselt es von einem getragenen Stil ins Schwungvolle. Das ist schon gitarrenlastig, dann wieder plunkert aber ein bisschen Elektronik rein. Ungewöhnlich, aber todsicher nicht langweilig. Wenn man sich darauf einlässt, versteht sich ...
Ich habe die CD »Concrete Memories« gehört, die auf den siebzigsten Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz anspielt. Auf der CD sind nur zwei Stücke enthalten, doch die haben es in sich; vor allem fällt die Stimme der Sängerin extrem auf.
Die Stimme ist dünn und hoch, aber dennoch ausdrucksstark. Sie vibriert manchmal, sie piepst und sie ist filigran. Wer mag, darf den Vergleich mit einer Elfe aus der Klischee-Schublade ziehen, möge aber bitte die Unter-Schublade mit Björk stecken lassen – das passt ebenso wenig wie Kate Bush. Das ist alles schon eigenständig, beim ersten Ton dadurch nicht eingängig, dann aber doch immer klarer und auch gelungener.
Die Musik ist die meiste Zeit zurückhaltend, gleichzeitig sehr vielseitig: Im Stück gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, und manchmal wechselt es von einem getragenen Stil ins Schwungvolle. Das ist schon gitarrenlastig, dann wieder plunkert aber ein bisschen Elektronik rein. Ungewöhnlich, aber todsicher nicht langweilig. Wenn man sich darauf einlässt, versteht sich ...
28 April 2015
Mit Nazis reden?
»Man muss doch mit den Leuten reden.« Das höre ich oft, wenn ich meine Meinung zu Pegidioten und anderen Wirrköpfen äußere. Ebenfalls gern gehört: »Das sind ja nicht alles Nazis; viele von denen könnte man durch gutes Zureden davon überzeugen, dass ihre Ansichten falsch sind.«
Das stelle ich mir dann gern vor: ich im Gespräch mit einem Pegidioten. Er oder sie: »Die Moslems betreiben eine Islamisierung Deutschlands, und dagegen will ich etwas tun.« Ich dann: »Das ist doch offenkundiger Unsinn. Es gibt bekloppte Muslime, gegen die muss meinetwegen die Justiz etwas tun – aber die Mehrheit von den Leuten ist nicht mehr und nicht weniger bescheuert als durchschnittliche Christen oder Atheisten.«
Er oder sie: »Aber die sind trotzdem gefährlich.« Ich: »Es ist trotzdem Unsinn.« Er oder sie: »Aber ... aber ... aber ...« Ich dann: »Unsinn. Unsinn. Unsinn.« So ginge es bei den meisten Diskussionspunkten. Meine Antwort wäre irgendwann, kreischend wegzulaufen oder eben zu sportlicheren Argumenten zu greifen.
Menschen, die voller Angst oder – wahlweise – Hass stecken, sind als Diskussionspartner zumindest für mich nicht sinnvoll. Ich habe weder Lust noch Zeit, mich mit Ansichten auseinanderzusetzen, die ich als rassistisch oder sonstwie hoffnungslos bescheuert ansehe.
Ich gehe ja auch nicht ins Diskussionsforum der NPD – haben die so was überhaupt? – und versuche die Mitglieder davon zu überzeugen, dass Ausländer auch nur »Menschen wie du und ich« sind. Das wäre vergebliche Liebesmüh'. Ebensowenig kann ich den örtlichen Superchristen oder Muslim-Fanatiker davon überzeugen, dass Schwule und Lesben auch nur »Menschen wie du und ich« sind. Warum sollte ich dann mit denen diskutieren?
Wer mag, der darf. Ich halte niemanden davon ab, mit Leuten zu diskutieren, die menschenverachtende Haltungen haben. Wer das mag, soll das tun. Mir ist dafür die Zeit zu schade. Nazis und ihre Sympathisanten sind schlichtweg nicht satisfaktionsfähig.
Das stelle ich mir dann gern vor: ich im Gespräch mit einem Pegidioten. Er oder sie: »Die Moslems betreiben eine Islamisierung Deutschlands, und dagegen will ich etwas tun.« Ich dann: »Das ist doch offenkundiger Unsinn. Es gibt bekloppte Muslime, gegen die muss meinetwegen die Justiz etwas tun – aber die Mehrheit von den Leuten ist nicht mehr und nicht weniger bescheuert als durchschnittliche Christen oder Atheisten.«
Er oder sie: »Aber die sind trotzdem gefährlich.« Ich: »Es ist trotzdem Unsinn.« Er oder sie: »Aber ... aber ... aber ...« Ich dann: »Unsinn. Unsinn. Unsinn.« So ginge es bei den meisten Diskussionspunkten. Meine Antwort wäre irgendwann, kreischend wegzulaufen oder eben zu sportlicheren Argumenten zu greifen.
Menschen, die voller Angst oder – wahlweise – Hass stecken, sind als Diskussionspartner zumindest für mich nicht sinnvoll. Ich habe weder Lust noch Zeit, mich mit Ansichten auseinanderzusetzen, die ich als rassistisch oder sonstwie hoffnungslos bescheuert ansehe.
Ich gehe ja auch nicht ins Diskussionsforum der NPD – haben die so was überhaupt? – und versuche die Mitglieder davon zu überzeugen, dass Ausländer auch nur »Menschen wie du und ich« sind. Das wäre vergebliche Liebesmüh'. Ebensowenig kann ich den örtlichen Superchristen oder Muslim-Fanatiker davon überzeugen, dass Schwule und Lesben auch nur »Menschen wie du und ich« sind. Warum sollte ich dann mit denen diskutieren?
Wer mag, der darf. Ich halte niemanden davon ab, mit Leuten zu diskutieren, die menschenverachtende Haltungen haben. Wer das mag, soll das tun. Mir ist dafür die Zeit zu schade. Nazis und ihre Sympathisanten sind schlichtweg nicht satisfaktionsfähig.
27 April 2015
Tolles Thema – aber leider ohne mich
Wer sich hinter dem Pseudonym J.J. Preyer verbirgt, weiß ich leider nicht. Im Programm des Blitz-Verlages ist der Autor gleich mit mehreren Titeln vertreten; unter anderem schreibt er für einige Serien, die der Verlag publiziert. Mit »Sherlock Holmes und der Flucht der Titanic« lieferte er einen Roman ab, der mich mehr als die Serien interessierte.
 Der Roman spielt nämlich viele Jahre nach den bekannten Fällen des Detektivs Sherlock Holmes. Im Jahr 1915 ist dieser längst im Ruhestand und wohnt auch nicht mehr in London. Aufgrund eines Telegramms seines Bruders fährt Holmes in die britische Metropole, wo er sich um eines der Geheimnisse der »Titanic« kümmern soll. Das Schiff war drei Jahre zuvor gesunken, ein Schock nicht nur für die britische Öffentlichkeit.
Der Roman spielt nämlich viele Jahre nach den bekannten Fällen des Detektivs Sherlock Holmes. Im Jahr 1915 ist dieser längst im Ruhestand und wohnt auch nicht mehr in London. Aufgrund eines Telegramms seines Bruders fährt Holmes in die britische Metropole, wo er sich um eines der Geheimnisse der »Titanic« kümmern soll. Das Schiff war drei Jahre zuvor gesunken, ein Schock nicht nur für die britische Öffentlichkeit.
In der Folge ist Holmes gezwungen, die Fahrt der »Titanic« nachzuvollziehen, mit einem anderen Schiff zwar, aber auf einer sehr ähnlichen Route. Das habe ich dann allerdings nicht mehr gelesen, weil der Roman es trotz des spannenden Themas nicht schaffte, mich zu packen.
Dabei macht der Autor vieles richtig. Man merkt seinem Roman an, dass er sauber recherchiert hat. Sowohl das London des Ersten Weltkriegs als auch die Figur des Sherlock Holmes wirken nachvollziehbar und überzeugen; das alles ist stimmig beschrieben. Mit den Geheimnissen um die »Titanic« fügt der Autor zudem eine Ebene hinzu, die gleichfalls faszinierend ist.
Trotzdem blieben mir die Figuren zu distanziert, der Fall fesselte mich nicht, der Stil blieb mir zu oft an der Oberfläche, ging kaum in die Tiefe. Letztlich plätschert die Handlung so dahin, bleibt es häufig bei einer Art von Nummernrevue, bei der eben allerlei Holmes-Elemente aneinander gereiht werden.
Ich finde das jetzt nicht schlimm. Nicht alles kann jedem gefallen. Und lese ich die entsprechenden Rezensionen im Internet, fanden viele Leser diesen Roman richtig gut. Für mich war »Sherlock Holmes und der Flucht der Titanic« einfach zu spannungsarm, so dass ich nach etwa 50 von 222 Seiten aufgab.
Andere Leser dürften dazu eine andere Meinung haben, weshalb ich gern auf die Internet-Seite des Blitz-Verlages verweise. In diesem Verlag ist der schön gestaltete Roman erschienen, und dort gibt es auch eine kostenlose Leseprobe ...
 Der Roman spielt nämlich viele Jahre nach den bekannten Fällen des Detektivs Sherlock Holmes. Im Jahr 1915 ist dieser längst im Ruhestand und wohnt auch nicht mehr in London. Aufgrund eines Telegramms seines Bruders fährt Holmes in die britische Metropole, wo er sich um eines der Geheimnisse der »Titanic« kümmern soll. Das Schiff war drei Jahre zuvor gesunken, ein Schock nicht nur für die britische Öffentlichkeit.
Der Roman spielt nämlich viele Jahre nach den bekannten Fällen des Detektivs Sherlock Holmes. Im Jahr 1915 ist dieser längst im Ruhestand und wohnt auch nicht mehr in London. Aufgrund eines Telegramms seines Bruders fährt Holmes in die britische Metropole, wo er sich um eines der Geheimnisse der »Titanic« kümmern soll. Das Schiff war drei Jahre zuvor gesunken, ein Schock nicht nur für die britische Öffentlichkeit.In der Folge ist Holmes gezwungen, die Fahrt der »Titanic« nachzuvollziehen, mit einem anderen Schiff zwar, aber auf einer sehr ähnlichen Route. Das habe ich dann allerdings nicht mehr gelesen, weil der Roman es trotz des spannenden Themas nicht schaffte, mich zu packen.
Dabei macht der Autor vieles richtig. Man merkt seinem Roman an, dass er sauber recherchiert hat. Sowohl das London des Ersten Weltkriegs als auch die Figur des Sherlock Holmes wirken nachvollziehbar und überzeugen; das alles ist stimmig beschrieben. Mit den Geheimnissen um die »Titanic« fügt der Autor zudem eine Ebene hinzu, die gleichfalls faszinierend ist.
Trotzdem blieben mir die Figuren zu distanziert, der Fall fesselte mich nicht, der Stil blieb mir zu oft an der Oberfläche, ging kaum in die Tiefe. Letztlich plätschert die Handlung so dahin, bleibt es häufig bei einer Art von Nummernrevue, bei der eben allerlei Holmes-Elemente aneinander gereiht werden.
Ich finde das jetzt nicht schlimm. Nicht alles kann jedem gefallen. Und lese ich die entsprechenden Rezensionen im Internet, fanden viele Leser diesen Roman richtig gut. Für mich war »Sherlock Holmes und der Flucht der Titanic« einfach zu spannungsarm, so dass ich nach etwa 50 von 222 Seiten aufgab.
Andere Leser dürften dazu eine andere Meinung haben, weshalb ich gern auf die Internet-Seite des Blitz-Verlages verweise. In diesem Verlag ist der schön gestaltete Roman erschienen, und dort gibt es auch eine kostenlose Leseprobe ...
26 April 2015
Xaver und das Phantastische Quartett
Das Phantastische Quartett – das sind vier Science-Fiction-Fans, die in den vergangenen Jahren auf Cons aufgetreten sind und dabei »Perlen der Science Fiction« präsentiert haben. Gesehen habe ich das Quartett in all den Jahren nicht, weil ich wohl auf die falschen Cons gehe. Mit dem Fanzine »!Xaver« gibt es jetzt ein Fanzine, in dem die vier Männer sich und ihre Arbeiten präsentieren.
Das Heft ist 68 Seiten stark, wurde im A5-Format gedruckt und überzeugt schon rein optisch durch ein vierfarbiges Titelbild und ein professionell wirkendes Layout. Kein Wunder: Für das Layout zeichnet Hardy Kettlitz verantwortlich, der seit Jahren für verschiedene Verlage im Science-Fiction-Bereich tätig ist.
Die Macher wollen »den Beweis erbringen, dass auch in Zeiten des Internets ein gedrucktes Fanzine seine Berechtigung hat und Spaß machen kann«. So steht es im Vorwort, und ich finde, das Versprechen wird eingelöst. Ich habe das Heft komplett gelesen, möchte jetzt sicher nicht damit anfangen, alle Details wiederzukäuen, war aber höchst zufrieden mit der Lektüre.
Die Artikel beschäftigen sich mit klassischen Phantastik-Filmen, in denen die USA angegriffen wird, mit dem Autor und Herausgeber Wolfgang Jeschke, dem Uplift-Universum des amerikanischen Schriftstellers David Brin oder auch mit der aktuellen Wissenschaft. Die vier Mitglieder des Phantatischen Quartetts, von denen ich nur Udo Klotz ein bisschen besser kenne, frönen dabei ihren höchst eigenen Vorlieben, lassen es am augenzwinkernden Humor nicht fehlen und informieren ganz nebenbei über allerlei Science-Fiction-Themen.
So muss in der heutigen Zeit ein Fanzine sein! Es muss echt Spaß machen – den Lesern und den Schreibern –, und es muss gut aussehen. Das tut »!Xaver«. (Das Heft kostet drei Euro plus Porto. Und zu beziehen ist es bei stef.kuhn-at-yahoo.de)
Das Heft ist 68 Seiten stark, wurde im A5-Format gedruckt und überzeugt schon rein optisch durch ein vierfarbiges Titelbild und ein professionell wirkendes Layout. Kein Wunder: Für das Layout zeichnet Hardy Kettlitz verantwortlich, der seit Jahren für verschiedene Verlage im Science-Fiction-Bereich tätig ist.
Die Macher wollen »den Beweis erbringen, dass auch in Zeiten des Internets ein gedrucktes Fanzine seine Berechtigung hat und Spaß machen kann«. So steht es im Vorwort, und ich finde, das Versprechen wird eingelöst. Ich habe das Heft komplett gelesen, möchte jetzt sicher nicht damit anfangen, alle Details wiederzukäuen, war aber höchst zufrieden mit der Lektüre.
Die Artikel beschäftigen sich mit klassischen Phantastik-Filmen, in denen die USA angegriffen wird, mit dem Autor und Herausgeber Wolfgang Jeschke, dem Uplift-Universum des amerikanischen Schriftstellers David Brin oder auch mit der aktuellen Wissenschaft. Die vier Mitglieder des Phantatischen Quartetts, von denen ich nur Udo Klotz ein bisschen besser kenne, frönen dabei ihren höchst eigenen Vorlieben, lassen es am augenzwinkernden Humor nicht fehlen und informieren ganz nebenbei über allerlei Science-Fiction-Themen.
So muss in der heutigen Zeit ein Fanzine sein! Es muss echt Spaß machen – den Lesern und den Schreibern –, und es muss gut aussehen. Das tut »!Xaver«. (Das Heft kostet drei Euro plus Porto. Und zu beziehen ist es bei stef.kuhn-at-yahoo.de)
25 April 2015
Films aus South Carolina
Ich weiß noch, wie begeistert ich von der ersten Platte der Strokes war: Die New Yorker brachten mit einer rüpelig klingenden Mischung aus stinknormaler Rock-Musik und einer gehörigen Punk-Attitüde in den Nullerjahren einen frischen Wind in die sogenannte Indie-Szene. Irgendwann wurde es ein wenig still um sie – aber es gibt eine Band namens The Films, die eigentlich ihre Nachfolge sein könnten.
The Films stammen aus Charleston in South Carolina, was nicht gerade als eine Szene-Hochburg bekannt geworden ist. Glaubt man dem Band-Info kennen sich die vier jungen Männer schon seit ihren Highschool-Zeiten; auf jeden Fall traten sie ab Mitte der Nullerjahre regelmäßig auf und brachten im Jahr 2007 ihre erste Platte mit dem hübschen Titel »Don't Dance Rattlesnake« heraus.
Musikalisch ist das ansprechender IndieRock: gute Melodien, flottes Geschrammel, saubere und dreckige Töne schön vermischt, immer ein gelungenes Gespür für den coolen Sound der heutigen Zeit. Die Band aus Charleston muss man sicher nicht gehört oder gesehen haben; wer sich aber für zeitgenössischen IndieRock interessiert, dürfte sie mögen.
The Films stammen aus Charleston in South Carolina, was nicht gerade als eine Szene-Hochburg bekannt geworden ist. Glaubt man dem Band-Info kennen sich die vier jungen Männer schon seit ihren Highschool-Zeiten; auf jeden Fall traten sie ab Mitte der Nullerjahre regelmäßig auf und brachten im Jahr 2007 ihre erste Platte mit dem hübschen Titel »Don't Dance Rattlesnake« heraus.
Musikalisch ist das ansprechender IndieRock: gute Melodien, flottes Geschrammel, saubere und dreckige Töne schön vermischt, immer ein gelungenes Gespür für den coolen Sound der heutigen Zeit. Die Band aus Charleston muss man sicher nicht gehört oder gesehen haben; wer sich aber für zeitgenössischen IndieRock interessiert, dürfte sie mögen.
24 April 2015
Ein idealer Schüler
Zu den krawalligen Geschichten, die ich im Jahr 1981 verfasste, zählt »Ein idealer Schüler«. Sie ist rasch erzählt: Es geht um die Konfrontation eines Schülers mit einer Gruppe von Lehrern, der zuvor die Auseinandersetzung mit einer Lehrerin vorausging. (Weil ich derzeit alte Geschichten von mir erfasse, um sie vielleicht mal als Büchlein zu veröffentlichen, war ich auch mit diesem Text beschäftigt.)
Als ich die Kurzgeschichte verfasste, ging ich selbst noch zur Schule, und das merkt man dem Text deutlich an. Einige Namen der Lehrer, die in diesem Text auftauchen, sind beispielsweise Namen entnommen, die es in der Wirklichkeit gab – nach mehr als dreißig Jahren dürfte das aber niemanden mehr stören.
Klar ist, dass sich hinter dem Schüler, über den ich schrieb, nichts anderes als ich selbst verberge; die Figur ist schwer überzeichnet, in der Wirklichkeit war ich wesentlich schüchterner – aber es ist eindeutig, dass ich mich selbst in eine Geschichte hineinschrieb. In diesen Jahren las ich viele Geschichten von Charles Bukowski und sah mich selbst als kommenden »Underground-Autor«.
Die Konfrontation mit den Lehrern, über deren Leben ich zu jener Zeit nichts wusste, ist völlig aus der Sicht eines angehenden Jungautors beschrieben ... Eine solche Konfrontation hatte ich nie, sie ist frei erfunden, aber ich stellte mir wohl immer wieder vor, wie ich mit Lehrern oder Lehrerinnen massiven Streit hatte.
Ich war weder so primitiv, einen derartigen Ton anzuschlagen, noch so mutig, gegen eine Lehrerin oder einen Lehrer wirklich so militant anzutreten. Gewünscht hatte ich es mir oft genug. Insofern ist es für mich durchaus interessant, einen solchen Text nach all den Jahren wieder anzuschauen: Ich hasste damals die Schule, und doch wusste ich, dass es sinnvoll war, sie zu besuchen. Mit 16, 17 Jahren darf man wohl so denken ...
Als ich die Kurzgeschichte verfasste, ging ich selbst noch zur Schule, und das merkt man dem Text deutlich an. Einige Namen der Lehrer, die in diesem Text auftauchen, sind beispielsweise Namen entnommen, die es in der Wirklichkeit gab – nach mehr als dreißig Jahren dürfte das aber niemanden mehr stören.
Klar ist, dass sich hinter dem Schüler, über den ich schrieb, nichts anderes als ich selbst verberge; die Figur ist schwer überzeichnet, in der Wirklichkeit war ich wesentlich schüchterner – aber es ist eindeutig, dass ich mich selbst in eine Geschichte hineinschrieb. In diesen Jahren las ich viele Geschichten von Charles Bukowski und sah mich selbst als kommenden »Underground-Autor«.
Die Konfrontation mit den Lehrern, über deren Leben ich zu jener Zeit nichts wusste, ist völlig aus der Sicht eines angehenden Jungautors beschrieben ... Eine solche Konfrontation hatte ich nie, sie ist frei erfunden, aber ich stellte mir wohl immer wieder vor, wie ich mit Lehrern oder Lehrerinnen massiven Streit hatte.
Ich war weder so primitiv, einen derartigen Ton anzuschlagen, noch so mutig, gegen eine Lehrerin oder einen Lehrer wirklich so militant anzutreten. Gewünscht hatte ich es mir oft genug. Insofern ist es für mich durchaus interessant, einen solchen Text nach all den Jahren wieder anzuschauen: Ich hasste damals die Schule, und doch wusste ich, dass es sinnvoll war, sie zu besuchen. Mit 16, 17 Jahren darf man wohl so denken ...
23 April 2015
Suriname Punks Meet Guyanese Punks
Tian An Men 89 Records sind auf ihrer stets amüsanten Suche nach Weltgegenden, die exotisch wirken und in denen dennoch Punkrock existiert, auch in jenen abgelegenen Winkel von Südamerika gekommen, den kaum einer hierzulande kennt: in die ehemalige niederländische Kolonie Surinam und in die ehemalige britische Kolonie Guyana, beide quasi oberhalb von Brasilien gelegen, beide eher klein und unwichtig, aber angeblich landschaftlich sehr schön. Die Split-EP für die Region trägt den Namen »Suriname Punks Meet Guyanese Punks«.
Die lustig klingenden De Rotte Appels schrammeln sich mit melodischem Chorgesang durch ihr Stück, während A Distant Head Disorder, die sich klugerweise ADHD abkürzen, einen ruppigen Hardcore-Punk spielen, der an die frühen 80er-Jahre der Amis erinnert. Inhaltlich schießen aber die Rotte Appels den Textpreis ab, und dazu benötige ich weder ein Textblatt noch eine Übersetzung – eine Band, die ihr Stück »Punkers Tot De Dood!« nennt, scheint über einen anständigen Humor zu verfügen.
Keep Your Day Job sind ein Duo aus Guyana: zwei Gitarristen, die abwechselnd singen und sich von einem Drumcomputer unterstützen lassen und unter anderem über die große Rebellion singen. Ihre zwei Stücke bilden einen hübschen Kontrast zu den zwei Bands auf der Surinam-Seite – eine gelungene Mischung!
(Eine Kurzfassung dieser Besprechung erschien im OX-Fanzine.)
Die lustig klingenden De Rotte Appels schrammeln sich mit melodischem Chorgesang durch ihr Stück, während A Distant Head Disorder, die sich klugerweise ADHD abkürzen, einen ruppigen Hardcore-Punk spielen, der an die frühen 80er-Jahre der Amis erinnert. Inhaltlich schießen aber die Rotte Appels den Textpreis ab, und dazu benötige ich weder ein Textblatt noch eine Übersetzung – eine Band, die ihr Stück »Punkers Tot De Dood!« nennt, scheint über einen anständigen Humor zu verfügen.
Keep Your Day Job sind ein Duo aus Guyana: zwei Gitarristen, die abwechselnd singen und sich von einem Drumcomputer unterstützen lassen und unter anderem über die große Rebellion singen. Ihre zwei Stücke bilden einen hübschen Kontrast zu den zwei Bands auf der Surinam-Seite – eine gelungene Mischung!
(Eine Kurzfassung dieser Besprechung erschien im OX-Fanzine.)
22 April 2015
Immer wieder Spenser
Einer der Autoren, die ich recht spät kennengelernt habe, ist Robert B. Parker. Seit ich zum ersten Mal einen »Spenser«-Roman von ihm las, sind höchstens zehn Jahre vergangen. In der Zwischenzeit habe ich mehrere Bücher aus dieser Serie durchgeschmökert und war von – fast – jedem Krimi ziemlich begeistert.
Die Art und Weise, wie der leider schon 2010 verstorbene Autor seinen Helden durch die Geschichten scheucht, ist nicht unbedingt außergewöhnlich, aber es ist einfach gut gemacht. Genau das merkt man auch auch dem Roman »Bitteres Ende« an, dem vorletzten »Spenser«-Roman, den Parker vor seinem Tod verfasst hat.
Die Geschichte: Eine Rechtsanwältin bittet den Privatdetektiv Spenser darum, gegen einen Erpresser vorzugehen. Sie hatte mit ihm eine Affäre, nicht nur sie, und er droht den einzelnen Damen jetzt, ihre Affäre auffliegen zu lassen. Das möchten die Damen natürlich verhindern – doch als Spenser damit anfängt, nach dem Schönling zu suchen, liegt recht schnell die erste Leiche herum. Ab dem Moment wird die eher harmlose Geschichte richtig kompliziert.
 Robert B. Parker erzählt die Geschichte in dem lakonischen Ton, den ich von ihm so mag. Seine Helden sprechen in klaren Sätzen, die Beschreibungen sind nüchtern, manchmal sarkastisch. Seine Hauptfigur ist sowieso ein Charakter, der ausführliches Schwätzen nicht schätzt. Wenn Spenser dann noch mit seinem Kameraden Hawk zusammenarbeitet – eigentlich ein Totschläger – oder die Psychologin Susan Silverman in der Handlung auftaucht, erhält man als Leser die Gelegenheit, zwischendurch zu grinsen.
Robert B. Parker erzählt die Geschichte in dem lakonischen Ton, den ich von ihm so mag. Seine Helden sprechen in klaren Sätzen, die Beschreibungen sind nüchtern, manchmal sarkastisch. Seine Hauptfigur ist sowieso ein Charakter, der ausführliches Schwätzen nicht schätzt. Wenn Spenser dann noch mit seinem Kameraden Hawk zusammenarbeitet – eigentlich ein Totschläger – oder die Psychologin Susan Silverman in der Handlung auftaucht, erhält man als Leser die Gelegenheit, zwischendurch zu grinsen.
Parker erzählt in einer filmischen Weise; man fühlt sich wie in einem klassischen Krimi, dessen Handlung schnurstracks auf ein eindeutiges Ziel zusteuert. Es gibt keine Abschweifungen, kein Gelaber, überhaupt nichts, was von der eigentlichen Geschichte ablenkt. Sogar die amüsanten Dialoge des Detektivs mit seiner Lebensgefährtin gehören zur Geschichte, ebenso das gemeinsame Kochen und Essen.
Ich weiß selbst, dass ich mich wiederhole, aber das macht an dieser Stelle nichts. Die Spenser-Krimis finde ich super, und »Bitteres Ende« ist ein – in positivem Sinne – sehr typischer und auch durchschnittlicher Roman dieser Reihe. Toll erzählt, spannend gemacht; so liebe ich einfach Kriminalromane.
(Erschienen ist das Werk im Pendragon-Verlag. Die 224 Seiten gibt's für 9,95 Euro; eine E-Book-Version gibt's auch.)
Die Art und Weise, wie der leider schon 2010 verstorbene Autor seinen Helden durch die Geschichten scheucht, ist nicht unbedingt außergewöhnlich, aber es ist einfach gut gemacht. Genau das merkt man auch auch dem Roman »Bitteres Ende« an, dem vorletzten »Spenser«-Roman, den Parker vor seinem Tod verfasst hat.
Die Geschichte: Eine Rechtsanwältin bittet den Privatdetektiv Spenser darum, gegen einen Erpresser vorzugehen. Sie hatte mit ihm eine Affäre, nicht nur sie, und er droht den einzelnen Damen jetzt, ihre Affäre auffliegen zu lassen. Das möchten die Damen natürlich verhindern – doch als Spenser damit anfängt, nach dem Schönling zu suchen, liegt recht schnell die erste Leiche herum. Ab dem Moment wird die eher harmlose Geschichte richtig kompliziert.
 Robert B. Parker erzählt die Geschichte in dem lakonischen Ton, den ich von ihm so mag. Seine Helden sprechen in klaren Sätzen, die Beschreibungen sind nüchtern, manchmal sarkastisch. Seine Hauptfigur ist sowieso ein Charakter, der ausführliches Schwätzen nicht schätzt. Wenn Spenser dann noch mit seinem Kameraden Hawk zusammenarbeitet – eigentlich ein Totschläger – oder die Psychologin Susan Silverman in der Handlung auftaucht, erhält man als Leser die Gelegenheit, zwischendurch zu grinsen.
Robert B. Parker erzählt die Geschichte in dem lakonischen Ton, den ich von ihm so mag. Seine Helden sprechen in klaren Sätzen, die Beschreibungen sind nüchtern, manchmal sarkastisch. Seine Hauptfigur ist sowieso ein Charakter, der ausführliches Schwätzen nicht schätzt. Wenn Spenser dann noch mit seinem Kameraden Hawk zusammenarbeitet – eigentlich ein Totschläger – oder die Psychologin Susan Silverman in der Handlung auftaucht, erhält man als Leser die Gelegenheit, zwischendurch zu grinsen.Parker erzählt in einer filmischen Weise; man fühlt sich wie in einem klassischen Krimi, dessen Handlung schnurstracks auf ein eindeutiges Ziel zusteuert. Es gibt keine Abschweifungen, kein Gelaber, überhaupt nichts, was von der eigentlichen Geschichte ablenkt. Sogar die amüsanten Dialoge des Detektivs mit seiner Lebensgefährtin gehören zur Geschichte, ebenso das gemeinsame Kochen und Essen.
Ich weiß selbst, dass ich mich wiederhole, aber das macht an dieser Stelle nichts. Die Spenser-Krimis finde ich super, und »Bitteres Ende« ist ein – in positivem Sinne – sehr typischer und auch durchschnittlicher Roman dieser Reihe. Toll erzählt, spannend gemacht; so liebe ich einfach Kriminalromane.
(Erschienen ist das Werk im Pendragon-Verlag. Die 224 Seiten gibt's für 9,95 Euro; eine E-Book-Version gibt's auch.)
21 April 2015
Hermann Ritter und das Ende von »Magira«
Im Sommer 2014 empfand ich es als kleinen Schock: »Magira« sollte eingestellt werde, das »Jahrbuch zur Fantasy« würde quasi seine Pforten schließen. Das machte mich einigermaßen sprachlos – ich selbst hatte einige Beiträge für das Buch geliefert und es immer wieder gern gelesen.
Nachdem bereits ein neues Jahr angebrochen ist und man sich eigentlich bereits auf ein neues Jahrbuch einstellen könnte, liegt es nahe, mit einem der Herausgeber ein kleines Interview zu führen. Mein Gesprächspartner ist Hermann Ritter, mit dem ich seit über dreißig Jahren befreundet bin; unser Interview wurde per Mail geführt.

Klaus N. Frick: Die Entwicklung von »Magira« ist ja eigentlich höchst verblüffend: vom Fanzine in den 70er-Jahren über das Magazin in den frühen 80er-Jahren bis hin zu dem Jahrbuch, zu dem es zuletzt mit Michael Scheuch und dir sowie Michael Haitel und dir geworden ist. Warum habt ihr eigentlich »damals« das »Magira« wiederbelebt?
Hermann Ritter: Weil das »Magira« immer ein Meilenstein war. Das erste deutsche Fantasy-Magazin – eingeschlafen, ohne schuld zu haben; nicht wirklich eingestellt, aber einfach länger nicht mehr erschienen. Da war es naheliegend, eine Wiederbelebung durchzuführen.
Klaus N. Frick: War es eigentlich kein seltsames Gefühl, in die Fußstapfen der »alten« Fantasy-Garde zu treten?
Hermann Ritter: Irgendwann stellt man fest, dass man selbst nach 30 Jahren Fandom zu einem der »Alten« geworden ist. Und dass man die Flamme weitergeben muss.
Klaus N. Frick: Und warum habt ihr jetzt nach all den Jahren das Jahrbuch eingestellt?
Hermann Ritter: Die Verkaufszahlen waren mies und wurden immer mieser. Dazu kam, dass das Interesse in den Reihen des herausgebenden FantasyClub e.V. immer geringer wurde. Ohne Zuarbeiten von außen wird das zu einer 2-Mann-Trapeznummer. Und das ist nicht durchzuhalten, wenn man nebenbei noch leben will.
Klaus N. Frick: Gibt es Gründe, warum die Leser weggeblieben sind? Mangelndes Marketing vielleicht?
Hermann Ritter: Wenn man kein Marketing hat, kann es keinen Mangel daran geben.
 Klaus N. Frick: Könnte es auch am Inhalt gelegen haben? Ich fand, dass das »Magira« oftmals tolle Artikel und Kurzgeschichten enthielt, leider aber auch viele Rezensionen, die – um es höflich zu sagen – nicht sonderlich professionell waren. Kann es sein, dass die Leser deshalb wegblieben, weil viele »Magira«-Inhalte sich kaum von denen irgendwelcher Blogs oder Amazon-Besprechungen unterschieden?
Klaus N. Frick: Könnte es auch am Inhalt gelegen haben? Ich fand, dass das »Magira« oftmals tolle Artikel und Kurzgeschichten enthielt, leider aber auch viele Rezensionen, die – um es höflich zu sagen – nicht sonderlich professionell waren. Kann es sein, dass die Leser deshalb wegblieben, weil viele »Magira«-Inhalte sich kaum von denen irgendwelcher Blogs oder Amazon-Besprechungen unterschieden?
Hermann Ritter: Als wir anfingen (2001), war es mit den Internet-Rezensionen noch nicht so. Und ich habe (Indianerehrenwort) immer über ein Drittel rausgestrichen – die Kunst der Rezension stirbt aus, weil das Internet den Standard drückt. Nicht anders herum.
Klaus N. Frick: Meinst du nicht, dass es für die Fantasy-Literatur besser wäre, wenn es ein vernünftiges Medium gäbe, dass die Entwicklung dieser Szene kritisch und ausführlich begleitet?
Hermann Ritter: Ja, es wäre gut. Nein, es wäre fast zwingend. Die Flut der Informationen ist groß, aber die »tatsächlichen Infos« (die Dinge, die man wirklich wissen will) werden immer weniger. Der Medien-Rummel für jeden kleinen Pups ist groß und wird immer und immer wieder online reproduziert. Da braucht man eine kritische Stimme ... die ich nicht sehe.«
Klaus N. Frick: Und wie geht es mit dir und der Fantasy jetzt weiter, nachdem es das »Magira« nicht mehr gibt?
Hermann Ritter: Ich bin da noch planlos. Mal sehen, ob mir jemand ein Angebot macht … oder ob ich nicht einfach die Dinge weiter mache, die mir Spaß machen – und dann schaue, wer sie druckt.
Klaus N. Frick: Vielen Dank für die schönen Antworten!
Hermann Ritter: Wie immer: Gerne. Und du warst der erste, der gefragt hat … auch ein Indiz, oder?
Nachdem bereits ein neues Jahr angebrochen ist und man sich eigentlich bereits auf ein neues Jahrbuch einstellen könnte, liegt es nahe, mit einem der Herausgeber ein kleines Interview zu führen. Mein Gesprächspartner ist Hermann Ritter, mit dem ich seit über dreißig Jahren befreundet bin; unser Interview wurde per Mail geführt.

Klaus N. Frick: Die Entwicklung von »Magira« ist ja eigentlich höchst verblüffend: vom Fanzine in den 70er-Jahren über das Magazin in den frühen 80er-Jahren bis hin zu dem Jahrbuch, zu dem es zuletzt mit Michael Scheuch und dir sowie Michael Haitel und dir geworden ist. Warum habt ihr eigentlich »damals« das »Magira« wiederbelebt?
Hermann Ritter: Weil das »Magira« immer ein Meilenstein war. Das erste deutsche Fantasy-Magazin – eingeschlafen, ohne schuld zu haben; nicht wirklich eingestellt, aber einfach länger nicht mehr erschienen. Da war es naheliegend, eine Wiederbelebung durchzuführen.
Klaus N. Frick: War es eigentlich kein seltsames Gefühl, in die Fußstapfen der »alten« Fantasy-Garde zu treten?
Hermann Ritter: Irgendwann stellt man fest, dass man selbst nach 30 Jahren Fandom zu einem der »Alten« geworden ist. Und dass man die Flamme weitergeben muss.
Klaus N. Frick: Und warum habt ihr jetzt nach all den Jahren das Jahrbuch eingestellt?
Hermann Ritter: Die Verkaufszahlen waren mies und wurden immer mieser. Dazu kam, dass das Interesse in den Reihen des herausgebenden FantasyClub e.V. immer geringer wurde. Ohne Zuarbeiten von außen wird das zu einer 2-Mann-Trapeznummer. Und das ist nicht durchzuhalten, wenn man nebenbei noch leben will.
Klaus N. Frick: Gibt es Gründe, warum die Leser weggeblieben sind? Mangelndes Marketing vielleicht?
Hermann Ritter: Wenn man kein Marketing hat, kann es keinen Mangel daran geben.
 Klaus N. Frick: Könnte es auch am Inhalt gelegen haben? Ich fand, dass das »Magira« oftmals tolle Artikel und Kurzgeschichten enthielt, leider aber auch viele Rezensionen, die – um es höflich zu sagen – nicht sonderlich professionell waren. Kann es sein, dass die Leser deshalb wegblieben, weil viele »Magira«-Inhalte sich kaum von denen irgendwelcher Blogs oder Amazon-Besprechungen unterschieden?
Klaus N. Frick: Könnte es auch am Inhalt gelegen haben? Ich fand, dass das »Magira« oftmals tolle Artikel und Kurzgeschichten enthielt, leider aber auch viele Rezensionen, die – um es höflich zu sagen – nicht sonderlich professionell waren. Kann es sein, dass die Leser deshalb wegblieben, weil viele »Magira«-Inhalte sich kaum von denen irgendwelcher Blogs oder Amazon-Besprechungen unterschieden? Hermann Ritter: Als wir anfingen (2001), war es mit den Internet-Rezensionen noch nicht so. Und ich habe (Indianerehrenwort) immer über ein Drittel rausgestrichen – die Kunst der Rezension stirbt aus, weil das Internet den Standard drückt. Nicht anders herum.
Klaus N. Frick: Meinst du nicht, dass es für die Fantasy-Literatur besser wäre, wenn es ein vernünftiges Medium gäbe, dass die Entwicklung dieser Szene kritisch und ausführlich begleitet?
Hermann Ritter: Ja, es wäre gut. Nein, es wäre fast zwingend. Die Flut der Informationen ist groß, aber die »tatsächlichen Infos« (die Dinge, die man wirklich wissen will) werden immer weniger. Der Medien-Rummel für jeden kleinen Pups ist groß und wird immer und immer wieder online reproduziert. Da braucht man eine kritische Stimme ... die ich nicht sehe.«
Klaus N. Frick: Und wie geht es mit dir und der Fantasy jetzt weiter, nachdem es das »Magira« nicht mehr gibt?
Hermann Ritter: Ich bin da noch planlos. Mal sehen, ob mir jemand ein Angebot macht … oder ob ich nicht einfach die Dinge weiter mache, die mir Spaß machen – und dann schaue, wer sie druckt.
Klaus N. Frick: Vielen Dank für die schönen Antworten!
Hermann Ritter: Wie immer: Gerne. Und du warst der erste, der gefragt hat … auch ein Indiz, oder?
20 April 2015
Eine dubiose Sandra schrieb
Manche Methoden von manchen Facebook-Nutzern werden immer absurder. Ein halbwegs aktuelles Beispiel hat damit zu tun, dass ich sehr viele »Freunde« habe – das liegt an meinem Beruf und nicht an meiner persönlichen Ausstrahlung; das ist mir schon selbst klar ... – und entsprechend locker mit »Freundesanfragen« umgehe: Wenn die andere Person nicht völlig daneben wirkt, wird ihre Anfrage akzeptiert. Ich tu' das schließlich nicht für mich, sondern für den Weltraumfahrer im blauen Raumanzug.
Wenn mich also eine »Sandra« anschreibt und in ihrem Profil nicht nur Unfug zu sehen ist, klicke ich auf ein »Bestätigen« und kümmere mich nicht weiter darum. Dann aber stelle ich fest, dass die gute Frau innerhalb von wenigen Minuten bei zahlreichen Postings von mir ihre Pseudo-Kommentare hinterlassen hat.
Unter der kryptischen Überschrift »Zeugnis des Darlehens« geht es in einer wunderlichen Sprache um »Weitere Verwechslungen. viel, dass Kreditgeber sagte!« – alle Schreibfehler sind jetzt eins zu eins von ihren Kommentaren übernommen. Irgendwie ging es in den Kommentaren darum, dass sie meinen »Freunden« wohl Werbung für Kredite vor die Augen halten wollte.
»Also, wenn Sie die Darlehen benötigen oder Sie haben Verwandte oder Freunde, die braucht Kredit für die Entwicklung eines Projekts oder was sein ...« Das klang glücklicherweise alles höchst ominös und seltsam; darauf fällt sicher niemand rein. Zudem war kein Link angegeben, sondern man sollte eine E-Mail an eine angegebene Adresse schreiben.
Aber es dauerte einige Minuten, bis ich »meine« Facebook-Seite von diesem ganzen Unfug gesäubert hatte. Selbstverständlich habe ich die »Freundschaft« gleich wieder beendeet und eine Spam-Meldung an Facebook geliefert.
So richtig kapiert habe ich das Ganze nicht. Niemand wird auf eine solche Nachricht hin eine E-Mail schreiben. Gelöscht ist der ganze Kram ebenfalls schnell. Welchen Erfolg verspricht sich die andere Seite dann von einer solchen Aktion?
Wenn mich also eine »Sandra« anschreibt und in ihrem Profil nicht nur Unfug zu sehen ist, klicke ich auf ein »Bestätigen« und kümmere mich nicht weiter darum. Dann aber stelle ich fest, dass die gute Frau innerhalb von wenigen Minuten bei zahlreichen Postings von mir ihre Pseudo-Kommentare hinterlassen hat.
Unter der kryptischen Überschrift »Zeugnis des Darlehens« geht es in einer wunderlichen Sprache um »Weitere Verwechslungen. viel, dass Kreditgeber sagte!« – alle Schreibfehler sind jetzt eins zu eins von ihren Kommentaren übernommen. Irgendwie ging es in den Kommentaren darum, dass sie meinen »Freunden« wohl Werbung für Kredite vor die Augen halten wollte.
»Also, wenn Sie die Darlehen benötigen oder Sie haben Verwandte oder Freunde, die braucht Kredit für die Entwicklung eines Projekts oder was sein ...« Das klang glücklicherweise alles höchst ominös und seltsam; darauf fällt sicher niemand rein. Zudem war kein Link angegeben, sondern man sollte eine E-Mail an eine angegebene Adresse schreiben.
Aber es dauerte einige Minuten, bis ich »meine« Facebook-Seite von diesem ganzen Unfug gesäubert hatte. Selbstverständlich habe ich die »Freundschaft« gleich wieder beendeet und eine Spam-Meldung an Facebook geliefert.
So richtig kapiert habe ich das Ganze nicht. Niemand wird auf eine solche Nachricht hin eine E-Mail schreiben. Gelöscht ist der ganze Kram ebenfalls schnell. Welchen Erfolg verspricht sich die andere Seite dann von einer solchen Aktion?
19 April 2015
Peterle zum fünfundfünfzigsten
Die aktuelle Ausgabe des OX-Fanzines trägt die Nummer 119; wieder ist eine Fortsetzung meines Romans »Und: Hardcore!« enthalten, dem dritten Teil der »Peter Pank«-Trilogie. Ich habe wirklich schon 55 Folgen dieses Romans veröffentlicht; davor habe ich sie zudem alle erst einmal geschrieben. Darüber nachdenken, wieviel Lebenszeit ich diesem Projekt geopfert habe, möchte ich dann doch lieber zu einem anderen Zeitpunkt.
Nach wie vor spielt die Handlung in einem Waldstück am Rand der Schwäbischen Alb. Mit dem Journalisten Remlow und einer mysteriösen Frau namens Tara ist Peter Pank an einem Einbruch beteiligt. Es geht darum, Beweise gegen eine örtliche Gruppierung von gut vernetzten Nazis zu finden, um diese gegebenenfalls gegen diese verwenden zu können. Nach dem Einbruch muss sich die kleine Gruppe im nächtlichen Wald einsetzen, während sich ein Auto dem Haus nähert, in dem die Nazis ihre Geheimnisse aufbewahren ...
Soweit der aktuelle Stand der »Peter Pank«-Trilogie. Bald ist sie zu Ende, dann wird aber eine andere Art von Fortsetzungsroman kommen. Zumindest habe ich mit der OX-Redaktion einige Eckpunkte besprochen; schauen wir mal, was ich davon wie umsetzen kann – noch ist ein wenig Zeit.
Nach wie vor spielt die Handlung in einem Waldstück am Rand der Schwäbischen Alb. Mit dem Journalisten Remlow und einer mysteriösen Frau namens Tara ist Peter Pank an einem Einbruch beteiligt. Es geht darum, Beweise gegen eine örtliche Gruppierung von gut vernetzten Nazis zu finden, um diese gegebenenfalls gegen diese verwenden zu können. Nach dem Einbruch muss sich die kleine Gruppe im nächtlichen Wald einsetzen, während sich ein Auto dem Haus nähert, in dem die Nazis ihre Geheimnisse aufbewahren ...
Soweit der aktuelle Stand der »Peter Pank«-Trilogie. Bald ist sie zu Ende, dann wird aber eine andere Art von Fortsetzungsroman kommen. Zumindest habe ich mit der OX-Redaktion einige Eckpunkte besprochen; schauen wir mal, was ich davon wie umsetzen kann – noch ist ein wenig Zeit.
18 April 2015
SF-Veränderungen 2015
Klammheimlich verändert sich im Jahr 2015 die Verlagslandschaft, und das wird Auswirkungen auf die Freunde und Freundinnen der phantastischen Literatur haben. Ich beginne mit dem aktuellsten Beispiel.
Seit dem 1. April ist der bisherige Verlag Harlequin Enterprises die HarperCollins Germany GmbH – damit ist der amerikanische Verlag HarperCollins offiziell direkt auf dem deutschen Markt tätig. Man wird verständlicherweise dann viele Genre-Titel nicht mehr lizenzieren, sondern sie direkt auf in den deutschsprachigen Markt bringen. Sowohl HarperCollins als auch Harlequin haben und hatten haufenweise Science Fiction und Fantasy im Programm.
Dasselbe gilt für Tor Books. Warum sollte dieser Verlag künftig seine SF- und Fantasy-Titel künftig weiterhin an deutsche Verlage lizenzieren, wenn man derzeit dabei ist, in Berlin eine eigenständige Tochtergesellschaft aufzuziehen?
Weitere Veränderungen: Der Piper-Verlag kündigt dieser Tage den Start einer eigenen Science-Fiction-Reihe an und beginnt unter anderem mit Autoren, die vorher bei anderen Verlagen unter Vertrag standen. Bei Droemer-Knaur hat die ehemalige Agentin Natalja Schmidt die Leitung im »phantastischen Bereich« übernommen.
Das Stühlerücken hat darüber hinaus die Kölner Verlage Bastei-Lübbe und Egmont-Lyx erfasst. Bei Verlagen wie Gmeiner, die bisher vor allem Krimis und Liebesromane veröffentlichten, kommen jetzt auf einmal E-Books mit Science-Fiction-Inhalten heraus.
Was schließen wir daraus? Phantastische Literatur ist nach wie vor ein Thema, auch und gerade in kritischen Zeiten. Wie sich das alles entwickelt, werde ich mit viel Interesse beäugen – ich finde das spannend.
Seit dem 1. April ist der bisherige Verlag Harlequin Enterprises die HarperCollins Germany GmbH – damit ist der amerikanische Verlag HarperCollins offiziell direkt auf dem deutschen Markt tätig. Man wird verständlicherweise dann viele Genre-Titel nicht mehr lizenzieren, sondern sie direkt auf in den deutschsprachigen Markt bringen. Sowohl HarperCollins als auch Harlequin haben und hatten haufenweise Science Fiction und Fantasy im Programm.
Dasselbe gilt für Tor Books. Warum sollte dieser Verlag künftig seine SF- und Fantasy-Titel künftig weiterhin an deutsche Verlage lizenzieren, wenn man derzeit dabei ist, in Berlin eine eigenständige Tochtergesellschaft aufzuziehen?
Weitere Veränderungen: Der Piper-Verlag kündigt dieser Tage den Start einer eigenen Science-Fiction-Reihe an und beginnt unter anderem mit Autoren, die vorher bei anderen Verlagen unter Vertrag standen. Bei Droemer-Knaur hat die ehemalige Agentin Natalja Schmidt die Leitung im »phantastischen Bereich« übernommen.
Das Stühlerücken hat darüber hinaus die Kölner Verlage Bastei-Lübbe und Egmont-Lyx erfasst. Bei Verlagen wie Gmeiner, die bisher vor allem Krimis und Liebesromane veröffentlichten, kommen jetzt auf einmal E-Books mit Science-Fiction-Inhalten heraus.
Was schließen wir daraus? Phantastische Literatur ist nach wie vor ein Thema, auch und gerade in kritischen Zeiten. Wie sich das alles entwickelt, werde ich mit viel Interesse beäugen – ich finde das spannend.
Düster-Country aus Trier
The Shanes sind sechs Männer und neuerdings eine Frau; die Band stammt – wenn ich es richtig kapiert habe – aus Trier und spielt eine originelle Mischung aus allerlei Rock-Stilrichtungen, Folk, Country und Polka. Ich habe die CD »The Girl Who Lives On Heaven Hill« erhalten, eine typische Promo-CD, die sich tatsächlich in mein Hirn gefräst hat.
Enthalten ist darauf dreimal das gleiche Stück – das ist bei Promo-CDs normal, weil sie ja fürs Radio gedacht sind. Das Titelstück stammt im Original von Hüsker Dü, die ich in den 80er-Jahren zeitweise sehr verehrt habe und die den heutigen IndieRock quasi mit-erfunden haben. Was im Original durchaus krachig ist, wird bei den Shanes zu einer melodisch-düsteren Pop-Nummer, die ein wenig an Folk oder Country erinnert.
Mithilfe der CD habe ich auf jeden Fall eine gute Band kennengelernt; auf der CD sind nämlich sieben weitere Stücke enthalten, teilweise live, teilweise aus dem Studio. Das ist im weitesten Sinne »Folk-Rock«, sofern diese Schublade überhaupt existiert, ziemlich düster angehaucht und mit einem starken Einschlag der frühen düsteren 80er-Jahre im Wave-Sound. Wer mag, kann als Vergleich so etwas wie The Alarm heranziehen.
Die Band ist auf jeden Fall eigenständig, die englischsprachigen Stücke werden mit viel Spielfreude präsentiert, das hat mich auf jeden Fall gepackt. Eine überraschende Band, von der ich nicht nur das Hüsker-Dü-Cover in Erinnerung behalten sollte!
Enthalten ist darauf dreimal das gleiche Stück – das ist bei Promo-CDs normal, weil sie ja fürs Radio gedacht sind. Das Titelstück stammt im Original von Hüsker Dü, die ich in den 80er-Jahren zeitweise sehr verehrt habe und die den heutigen IndieRock quasi mit-erfunden haben. Was im Original durchaus krachig ist, wird bei den Shanes zu einer melodisch-düsteren Pop-Nummer, die ein wenig an Folk oder Country erinnert.
Mithilfe der CD habe ich auf jeden Fall eine gute Band kennengelernt; auf der CD sind nämlich sieben weitere Stücke enthalten, teilweise live, teilweise aus dem Studio. Das ist im weitesten Sinne »Folk-Rock«, sofern diese Schublade überhaupt existiert, ziemlich düster angehaucht und mit einem starken Einschlag der frühen düsteren 80er-Jahre im Wave-Sound. Wer mag, kann als Vergleich so etwas wie The Alarm heranziehen.
Die Band ist auf jeden Fall eigenständig, die englischsprachigen Stücke werden mit viel Spielfreude präsentiert, das hat mich auf jeden Fall gepackt. Eine überraschende Band, von der ich nicht nur das Hüsker-Dü-Cover in Erinnerung behalten sollte!
17 April 2015
Spaziergang mit Blaulicht
(Fortsetzung des Berichtes von gestern ...)
Nachdem die Polizei am Dienstag abend damit begonnen hatte, nach irgendwelchen Kriterien einzelne Leute festzunehmen, entschlossen sich die Leute vom Antifa-Bündnis – oder wie das offiziell heißt –, in einer gemeinsam Spontan-Demonstration abzuziehen. An dieser Stelle erwies sich wohl, wie ich hinterher vernahm, eine Politikerin der Linkspartei als extrem hilfsbereit und hilfreich: Sie stellte sich an die Spitze des Zuges, sie verhandelte mit dem Ordnungsamt und der Polizei, und dann zog die Demonstration los, ohne dass die Polizei weitere Schikanen unternahm.
Allerdings hatte das sich danach entwickelte Schauspiel seinen eigenen Reiz. Ich bekam es mit, als ich zuerst zu meinem Fahrrad ging und dann über die nächtliche Kaiserstraße fuhr: Auf einmal tauchte mitten auf dieser Einkaufsmeile, die nachts vor allem von Fußgängern und der Straßenbahn frequentiert wird, eine Kolonne der Polizei auf, mit Blaulicht und in überhöhtem Tempo. Ebenso plötzlich hielten die Fahrzeuge mitten auf der Straße an – es sah aus, als wisse in der Truppe niemand, wohin man sich zu wenden hatte. Dann bog man hektisch in eine Nebenstraße ab.
Dieses Schauspiel sah ich noch öfter an diesem Abend. Die spontane Antifa-Demonstration marschierte quer durch die Stadt, lauthals Parolen rufend und skandierend, das Transparent vorne, ein recht stabiler Block vorne, dahinten locker die anderen Leute – alles in allem vielleicht 150 Personen.
Vorneweg rollte ein halbes Dutzend Polizeifahrzeuge, dann kamen bewaffnete Polizisten. Hinterher rollte ein halbes Dutzend Polizeifahrzeuge, ebenfalls unterstützt durch Dutzende bewaffneter Polizisten. Rechts und links marschierten Polizeibeamte in voller Kampfmontur. Auf rund 150 friedliche Leute, meist jünger, kamen gut 300 Polizisten.
Ganz ehrlich: Da hat sich die Polizei nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die meisten Passanten, die dem Aufzug irritiert zuschauten, amüsierten sich sogar darüber.
Immer wieder wurde der Zug verlangsamt, immer wieder gab es Diskussionen an der Spitze. Mit meinem Rad begleitete ich – wie einige andere Leute – die Demonstration von außen; es interessierte mich schließlich, wie dieser Dienstag zu Ende gehen würde.
Am Werderplatz in der Südstadt endete schließlich alles. Die Polizei gab ihre provozierende Haltung auf; später sah man überall Beamte stehen, die sich ihrer Kampfausrüstung entledigten und in entspannter Haltung eine Zigarette rauchten oder ein Schwätzchen hielten. Ich trank ein Bier vor der »Planwirtschaft« und unterhielt mich an der frischen Luft, bevor ich nach Hause fuhr.
Nachdem die Polizei am Dienstag abend damit begonnen hatte, nach irgendwelchen Kriterien einzelne Leute festzunehmen, entschlossen sich die Leute vom Antifa-Bündnis – oder wie das offiziell heißt –, in einer gemeinsam Spontan-Demonstration abzuziehen. An dieser Stelle erwies sich wohl, wie ich hinterher vernahm, eine Politikerin der Linkspartei als extrem hilfsbereit und hilfreich: Sie stellte sich an die Spitze des Zuges, sie verhandelte mit dem Ordnungsamt und der Polizei, und dann zog die Demonstration los, ohne dass die Polizei weitere Schikanen unternahm.
Allerdings hatte das sich danach entwickelte Schauspiel seinen eigenen Reiz. Ich bekam es mit, als ich zuerst zu meinem Fahrrad ging und dann über die nächtliche Kaiserstraße fuhr: Auf einmal tauchte mitten auf dieser Einkaufsmeile, die nachts vor allem von Fußgängern und der Straßenbahn frequentiert wird, eine Kolonne der Polizei auf, mit Blaulicht und in überhöhtem Tempo. Ebenso plötzlich hielten die Fahrzeuge mitten auf der Straße an – es sah aus, als wisse in der Truppe niemand, wohin man sich zu wenden hatte. Dann bog man hektisch in eine Nebenstraße ab.
Dieses Schauspiel sah ich noch öfter an diesem Abend. Die spontane Antifa-Demonstration marschierte quer durch die Stadt, lauthals Parolen rufend und skandierend, das Transparent vorne, ein recht stabiler Block vorne, dahinten locker die anderen Leute – alles in allem vielleicht 150 Personen.
Vorneweg rollte ein halbes Dutzend Polizeifahrzeuge, dann kamen bewaffnete Polizisten. Hinterher rollte ein halbes Dutzend Polizeifahrzeuge, ebenfalls unterstützt durch Dutzende bewaffneter Polizisten. Rechts und links marschierten Polizeibeamte in voller Kampfmontur. Auf rund 150 friedliche Leute, meist jünger, kamen gut 300 Polizisten.
Ganz ehrlich: Da hat sich die Polizei nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die meisten Passanten, die dem Aufzug irritiert zuschauten, amüsierten sich sogar darüber.
Immer wieder wurde der Zug verlangsamt, immer wieder gab es Diskussionen an der Spitze. Mit meinem Rad begleitete ich – wie einige andere Leute – die Demonstration von außen; es interessierte mich schließlich, wie dieser Dienstag zu Ende gehen würde.
Am Werderplatz in der Südstadt endete schließlich alles. Die Polizei gab ihre provozierende Haltung auf; später sah man überall Beamte stehen, die sich ihrer Kampfausrüstung entledigten und in entspannter Haltung eine Zigarette rauchten oder ein Schwätzchen hielten. Ich trank ein Bier vor der »Planwirtschaft« und unterhielt mich an der frischen Luft, bevor ich nach Hause fuhr.
16 April 2015
Blockade und Prügel
Am Dienstag, 14. April 2015, lud die Pegida in Karlsruhe zu ihrem »Spaziergang 6.0«, wie sie es nannten. Nachdem ich bei den letzten Aufmärschen dieser Art geschwächelt hatte, wollte ich dieses Mal unbedingt dabei sein. Ich war einigermaßen pünktlich am Stefansplatz mitten in der Stadt, wo eine Polizeikette zwei Kundgebungen trennte.
Weil es bereits um 16 Uhr eine Besetzung des Platzes durch Antifaschisten gegegeben hatte, war die Polizei dazu gezwungen gewesen, den Platz zu räumen. Das hatte sie nur zur Hälfte durchgezogen. So kam es zu der bizarren Situation, dass die Pegida auf der einen Hälfte des Platzes ihre Kundgebung machte, während die Gegendkundgebung in Sicht- und Hörweite stattfand.
Ich blieb recht lange bei diesem »bürgerlichen Teil« der Demonstration; zusammen mit einigen hundert anderen Leuten. Das passte: Weil ich direkt von der Arbeit gekommen war, trug ich Halbschuhe, Hemd und Jackett, sah also mit meiner Brille und meiner Durchschnittsfrisur sehr bürgerlich aus und nicht wie ein »Berufsdemonstrant«.
Später ging ich einige Meter weiter und stellte mich auf die Kreuzung Amalien- und Karlstraße. An dieser Kreuzung musste der Aufmarsch der Pegida vorbeiziehen, zumindest war so die Route ihrer Demonstration geplant. Überall zog Polizei auf, die Beamten verhielten sich aber zurückhaltend. Wir waren vielleicht 300 oder 400 Leute in diesem Bereich der Stadt.
Als die Pegida mit ihrem »Spaziergang« loslegte, nahm sie eine andere Route als geplant. Wie es sich herausstellte, lief die bizarre Gruppierung die geplante Route einfach in umgekehrter Richtung. Das bot der Polizei die Möglichkeit, in aller Ruhe die von uns besetzte Kreuzung zu räumen ...
Es begann mit einer Durchsage. Ein Polizist forderte uns auf, die Kreuzung freizumachen. Niemand wich. Es gab eine zweite und eine dritte Durchsage. Polizisten in kompletter Kampfmontur stellten sich auf und begannen damit, einzelne Leute herumzuschubsen.
Das dauerte eine Weile und ging hin und her. Nachdem ich einige Male mehr oder weniger massiv geschubst worden war, trat ich immer wieder einen halben Meter zurück. Aktivisten der Antifa, die ihre Transparente hielten, wurden stärker bedrängt, hier kam es zu stärkeren Handgreiflichkeiten der Polizei.
Einige Dutzend Leute begannen mit einer Sitzblockade. Sprechchöre mit »Wir sind friedlich – was seid ihr?« wurden laut. Die Polizei wurde aggressiver, das Schubsen wurde definitiv knalliger. Mir passierte nichts – auch deshalb, weil ich mich zurückschubsen ließ.
Dann begann an einer Stelle des Platzes auf einmal eine fiese Knüppelei; Polizisten drängten in die Blockade hinein und schlugen mit ihren Knüppeln um sich, zogen sich dann wieder zurück. An diesen Stellen gab es teilweise erhebliche Verletzungen bei den friedlichen Demonstranten.
Nach einer halben Stunde hatten die Beamten mit dieser Methode die Kreuzung zur Hälfte geräumt. In meinen Augen hatte die Stadt Karlsruhe – das Ordnungsamt ist für solche Dinge letztlich zuständig – schon klar Flagge gezeigt ...
Gitter wurden aufgestellt, die Polizisten zogen sich hinter die Gitter zurück; dann parkten sie Fahrzeuge als Sichtschutz davor. Als die Pegida-Demonstration kam, marschierte sie gut zehn Meter vor uns hinter den parkenden Fahrzeugen hindurch.
Ich schaute mir den Mob aus verwirrten Bürgern und echten Prügelnazis an – mehr als 150 Leute waren es nicht. Dafür wurde an diesem Tag die halbe Innenstadt lahmgelegt, dafür standen gut tausend Polizisten in der Stadt.
Ungeschoren erreichten die Pegidioten wieder den Stefansplatz. Die Polizei riegelte alles ab, die Pegidioten leiteten ihre nächste Kundgebung ein. Aus allen Richtungen umringten Protestierende aller Art den Platz, von allen Seiten wurde gepfiffen und gebuht.
Es war eine seltsame Situation: Überall waren Demonstranten, davor stand die aggressiv wirkende Polizei in kompletter Kampfmontur. Bei manchen Beamten hatte ich das Gefühl, dass sie nur darauf warteten, endlich prügeln zu dürfen; die Körpersprache machte auf mich keinen sehr entspannten Eindruck.
Ich sah es nicht, aber es wurde mir glaubhaft versichert – auf einmal begann die Polizei damit, willkürlich Leute aus den Reihen der Demonstranten herauszufischen und festzunehmen. Antifa-Aktivisten machten eine Durchsage: Man möchte sich sammeln, man wolle im Rahmen einer Spontan-Demonstration einen Rückzug vom Stefansplatz in die Südstadt antreten.
(Fortsetzung folgt.)
Weil es bereits um 16 Uhr eine Besetzung des Platzes durch Antifaschisten gegegeben hatte, war die Polizei dazu gezwungen gewesen, den Platz zu räumen. Das hatte sie nur zur Hälfte durchgezogen. So kam es zu der bizarren Situation, dass die Pegida auf der einen Hälfte des Platzes ihre Kundgebung machte, während die Gegendkundgebung in Sicht- und Hörweite stattfand.
Ich blieb recht lange bei diesem »bürgerlichen Teil« der Demonstration; zusammen mit einigen hundert anderen Leuten. Das passte: Weil ich direkt von der Arbeit gekommen war, trug ich Halbschuhe, Hemd und Jackett, sah also mit meiner Brille und meiner Durchschnittsfrisur sehr bürgerlich aus und nicht wie ein »Berufsdemonstrant«.
Später ging ich einige Meter weiter und stellte mich auf die Kreuzung Amalien- und Karlstraße. An dieser Kreuzung musste der Aufmarsch der Pegida vorbeiziehen, zumindest war so die Route ihrer Demonstration geplant. Überall zog Polizei auf, die Beamten verhielten sich aber zurückhaltend. Wir waren vielleicht 300 oder 400 Leute in diesem Bereich der Stadt.
Als die Pegida mit ihrem »Spaziergang« loslegte, nahm sie eine andere Route als geplant. Wie es sich herausstellte, lief die bizarre Gruppierung die geplante Route einfach in umgekehrter Richtung. Das bot der Polizei die Möglichkeit, in aller Ruhe die von uns besetzte Kreuzung zu räumen ...
Es begann mit einer Durchsage. Ein Polizist forderte uns auf, die Kreuzung freizumachen. Niemand wich. Es gab eine zweite und eine dritte Durchsage. Polizisten in kompletter Kampfmontur stellten sich auf und begannen damit, einzelne Leute herumzuschubsen.
Das dauerte eine Weile und ging hin und her. Nachdem ich einige Male mehr oder weniger massiv geschubst worden war, trat ich immer wieder einen halben Meter zurück. Aktivisten der Antifa, die ihre Transparente hielten, wurden stärker bedrängt, hier kam es zu stärkeren Handgreiflichkeiten der Polizei.
Einige Dutzend Leute begannen mit einer Sitzblockade. Sprechchöre mit »Wir sind friedlich – was seid ihr?« wurden laut. Die Polizei wurde aggressiver, das Schubsen wurde definitiv knalliger. Mir passierte nichts – auch deshalb, weil ich mich zurückschubsen ließ.
Dann begann an einer Stelle des Platzes auf einmal eine fiese Knüppelei; Polizisten drängten in die Blockade hinein und schlugen mit ihren Knüppeln um sich, zogen sich dann wieder zurück. An diesen Stellen gab es teilweise erhebliche Verletzungen bei den friedlichen Demonstranten.
Nach einer halben Stunde hatten die Beamten mit dieser Methode die Kreuzung zur Hälfte geräumt. In meinen Augen hatte die Stadt Karlsruhe – das Ordnungsamt ist für solche Dinge letztlich zuständig – schon klar Flagge gezeigt ...
Gitter wurden aufgestellt, die Polizisten zogen sich hinter die Gitter zurück; dann parkten sie Fahrzeuge als Sichtschutz davor. Als die Pegida-Demonstration kam, marschierte sie gut zehn Meter vor uns hinter den parkenden Fahrzeugen hindurch.
Ich schaute mir den Mob aus verwirrten Bürgern und echten Prügelnazis an – mehr als 150 Leute waren es nicht. Dafür wurde an diesem Tag die halbe Innenstadt lahmgelegt, dafür standen gut tausend Polizisten in der Stadt.
Ungeschoren erreichten die Pegidioten wieder den Stefansplatz. Die Polizei riegelte alles ab, die Pegidioten leiteten ihre nächste Kundgebung ein. Aus allen Richtungen umringten Protestierende aller Art den Platz, von allen Seiten wurde gepfiffen und gebuht.
Es war eine seltsame Situation: Überall waren Demonstranten, davor stand die aggressiv wirkende Polizei in kompletter Kampfmontur. Bei manchen Beamten hatte ich das Gefühl, dass sie nur darauf warteten, endlich prügeln zu dürfen; die Körpersprache machte auf mich keinen sehr entspannten Eindruck.
Ich sah es nicht, aber es wurde mir glaubhaft versichert – auf einmal begann die Polizei damit, willkürlich Leute aus den Reihen der Demonstranten herauszufischen und festzunehmen. Antifa-Aktivisten machten eine Durchsage: Man möchte sich sammeln, man wolle im Rahmen einer Spontan-Demonstration einen Rückzug vom Stefansplatz in die Südstadt antreten.
(Fortsetzung folgt.)
15 April 2015
Fragen zur Pegida
Nachdem ich mir den gestrigen Pegida-Aufmarsch in Karlsruhe doch ein wenig angeschaut habe – immerhin gab es eine Situation, in der dieser Mob in einem Abstand von etwa zehn Metern vor meinen Augen entlangzog –, gibt es eine Reihe von Fragen, die sich mir stellen. Die Antworten fallen mir ja meist schnell ein.
Die meisten Pegida-Menschen, die sich in der Öffentlichkeit äußern – auch bei Facebook und auf anderen Internet-Seiten –, sind entsetzt darüber, dass man sie als »Nazis« beschimpft. Sie seien keine Nazis, sie seien Patrioten; mit Nazis hätten sie nichts zu tun. Einem Teil der Pegida-Demonstranten nehme ich sogar ab, dass sie keine Nazis sind.
Mal vom rein Inhaltlichen abgesehen: Wer sich nicht als Nazi sieht, sollte nicht mit Nazis zusammen demonstrieren. Und wer sich nicht als Nazi sieht, sollte sich nicht wie ein Nazi benehmen und artikulieren. Wer Gegendemonstranten pauschal als – ich zitiere wörtlich aus Facebook – »intolerantes versyfftes linksgesindel« bezeichnet, darf sich nicht wundern, wenn ihn diese Demonstranten dann als Nazi ansehen. So einfach ist das.
Was ich aber nicht verstehe, ist allerdings doch, wie jemand auf so einer Demo mitlaufen kann, der eine Israel-Flagge trägt. Teilweise hatte diese Person diese Flagge so um sich gewickelt, dass man den blauen Stern auf weißem Grund sehr klar und deutlich sah. Wie kann man eine solche Fahne tragen und bei einem »Spaziergang« mitmachen, in dem Leute den Ton angeben, die sonst – um es vorsichtig zu sagen – für Menschen jüdischen Glaubens eine eher geringe Sympathie aufbringen?
Schon klar: Siegheilnazis und normale Pegidatrottel eint die Ablehnung des Islam. Dieser bedroht Israel. Also passt eine Israel-Flagge auch zu irgendwelchen beinharten Kameraden. Verstehen muss ich das trotzdem nicht.
(Der ausführliche Bericht zur folgt dann morgen. Versprochen.)
Die meisten Pegida-Menschen, die sich in der Öffentlichkeit äußern – auch bei Facebook und auf anderen Internet-Seiten –, sind entsetzt darüber, dass man sie als »Nazis« beschimpft. Sie seien keine Nazis, sie seien Patrioten; mit Nazis hätten sie nichts zu tun. Einem Teil der Pegida-Demonstranten nehme ich sogar ab, dass sie keine Nazis sind.
Mal vom rein Inhaltlichen abgesehen: Wer sich nicht als Nazi sieht, sollte nicht mit Nazis zusammen demonstrieren. Und wer sich nicht als Nazi sieht, sollte sich nicht wie ein Nazi benehmen und artikulieren. Wer Gegendemonstranten pauschal als – ich zitiere wörtlich aus Facebook – »intolerantes versyfftes linksgesindel« bezeichnet, darf sich nicht wundern, wenn ihn diese Demonstranten dann als Nazi ansehen. So einfach ist das.
Was ich aber nicht verstehe, ist allerdings doch, wie jemand auf so einer Demo mitlaufen kann, der eine Israel-Flagge trägt. Teilweise hatte diese Person diese Flagge so um sich gewickelt, dass man den blauen Stern auf weißem Grund sehr klar und deutlich sah. Wie kann man eine solche Fahne tragen und bei einem »Spaziergang« mitmachen, in dem Leute den Ton angeben, die sonst – um es vorsichtig zu sagen – für Menschen jüdischen Glaubens eine eher geringe Sympathie aufbringen?
Schon klar: Siegheilnazis und normale Pegidatrottel eint die Ablehnung des Islam. Dieser bedroht Israel. Also passt eine Israel-Flagge auch zu irgendwelchen beinharten Kameraden. Verstehen muss ich das trotzdem nicht.
(Der ausführliche Bericht zur folgt dann morgen. Versprochen.)
Seminar und Anmeldeschluss
Ich bin mal wieder als Dozent bei einem Science-Fiction-Seminar für Kurzgeschichten-Autoren tätig – und der Anmeldeschluss dafür ist diese Woche. Deshalb weise ich hier an dieser Stelle darauf hin und zitiere mal aus einem Informationstext:
»Lang kann jeder« – so lautet ein Spruch, wenn es um das Schreiben von Geschichten geht. Wie aber gelingt es mir, meinen Schreibfluss zu kanalisieren? Den Strom der Worte zielgerichtet fließen zu lassen? Solchen und ähnlichen Fragen geht die Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel in ihrer Werkstatt zur phantastischen Kurzgeschichte am Beispiel von eigenen und fremden Texten nach.
»Klassische Ideen neu interpretieren – Die phantastische Kurzgeschichte«: So heißt das Seminar, an dem ich neben dem Schriftsteller und Übersetzer Uwe Anton tätig bin. Es findet vom 15. bis 17. Mai 2015 statt. Die drei Tage kosten 198 Euro; die Übernachtung sowie die Mahlzeiten sind für die Seminarteilnehmer in diesem Preis enthalten.
Die Anmeldung zu den Seminaren ist über die Internet-Seite der Akademie möglich – übrigens noch bis zum 17. April 2015. Dort gibt es auch weitere Informationen.
»Lang kann jeder« – so lautet ein Spruch, wenn es um das Schreiben von Geschichten geht. Wie aber gelingt es mir, meinen Schreibfluss zu kanalisieren? Den Strom der Worte zielgerichtet fließen zu lassen? Solchen und ähnlichen Fragen geht die Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel in ihrer Werkstatt zur phantastischen Kurzgeschichte am Beispiel von eigenen und fremden Texten nach.
»Klassische Ideen neu interpretieren – Die phantastische Kurzgeschichte«: So heißt das Seminar, an dem ich neben dem Schriftsteller und Übersetzer Uwe Anton tätig bin. Es findet vom 15. bis 17. Mai 2015 statt. Die drei Tage kosten 198 Euro; die Übernachtung sowie die Mahlzeiten sind für die Seminarteilnehmer in diesem Preis enthalten.
Die Anmeldung zu den Seminaren ist über die Internet-Seite der Akademie möglich – übrigens noch bis zum 17. April 2015. Dort gibt es auch weitere Informationen.
14 April 2015
SAGITTARIUS wieder neu?
Mein Fanzine SAGITTARIUS ist Geschichte – es existierte von 1980 an, war zeitweise ein semiprofessionelles Magazin, erlebte diverse Auferstehungen und ist jetzt endgültig tot. Ich gedenke nicht, es als Druckwerk noch einmal auferstehen zu lassen. Was ich derzeit überlege, ist aber eine Art Science-Fiction-Blog – allerdings will ich die Welt auch nicht mit Blogs zuscheißen.
Bisher ist mein ENPUNKT-Blog der Raum, an dem ich alles bündle (und ich spiegle ihn via Facebook und Google+; allerdings nur eingeschränkt). Hier schreibe ich über Science Fiction und Punkrock, Politik und Reisen, Essen und Trinken, Musik und Kultur – sprich, es ist ein Egozine in nicht-gedruckter Form, das mir seit 2005 echt Freude bereitet. (Und die Zugriffe sind für so einen Egozine-Blog ganz ordentlich.)
Immer wieder denke ich allerdings, dass die Verwirrung nicht gut ist. Vielleicht wäre es sinnvoll, eine separate Seite für Science Fiction, Fantasy und all den anderen phantastischen Kram zu haben; da wären dann die entsprechenden Texte besser untergebracht, unter anderem eben Interviews zu aktuellen SF- oder Fantasy-Themen oder andere kürzere Interviews mit Autorinnen und Autoren, Lektoren, Künstlern, Verlagsleuten und so weiter.
Ich bin derzeit ein wenig ratlos. Vielleicht hat jemand einen Tipp: Mache ich noch einen Blog auf, bündle ich alles weiterhin bei ENPUNKT oder soll ich's aus reiner Faulheit lassen?
Bisher ist mein ENPUNKT-Blog der Raum, an dem ich alles bündle (und ich spiegle ihn via Facebook und Google+; allerdings nur eingeschränkt). Hier schreibe ich über Science Fiction und Punkrock, Politik und Reisen, Essen und Trinken, Musik und Kultur – sprich, es ist ein Egozine in nicht-gedruckter Form, das mir seit 2005 echt Freude bereitet. (Und die Zugriffe sind für so einen Egozine-Blog ganz ordentlich.)
Immer wieder denke ich allerdings, dass die Verwirrung nicht gut ist. Vielleicht wäre es sinnvoll, eine separate Seite für Science Fiction, Fantasy und all den anderen phantastischen Kram zu haben; da wären dann die entsprechenden Texte besser untergebracht, unter anderem eben Interviews zu aktuellen SF- oder Fantasy-Themen oder andere kürzere Interviews mit Autorinnen und Autoren, Lektoren, Künstlern, Verlagsleuten und so weiter.
Ich bin derzeit ein wenig ratlos. Vielleicht hat jemand einen Tipp: Mache ich noch einen Blog auf, bündle ich alles weiterhin bei ENPUNKT oder soll ich's aus reiner Faulheit lassen?
13 April 2015
Einige Worte zu Grass
Ich habe, wenn ich mich nicht irre, von Günter Grass in meinem ganzen Leben keinen Roman gelesen. Ich erinnere mich an einige Gedichte, die ich teilweise grausig fand – vor allem das israelfeindliche Machwerk, mit dem er vor einigen Jahren an die Öffentlichkeit trat –, ich kenne mit »Die Blechtrommel« eine sensationelle Verfilmung, und ich bilde mir ein, von ihm einige kürzere Texte gelesen zu haben.
Am heutigen Montag ist Günter Grass gestorben, der Literaturnobelpreisträger wurde 87 Jahre alt. Auch wenn ich sein literarisches Werk praktisch nicht kenne und sein künstlerisches Werk eher seltsam finde (diese Krakelbilder ...), finde ich das in gewisser Weise traurig.
Zumindest zeitweise war der Mann eine »moralische Institution« in diesem Land, bis er vor einigen Jahren mit diesem Israel-Text und seinen merkwürdigen Ausflüchten zur SS-Mitgliedschaft zu Recht in Misskredit geriet. (Zur SS hätte er sich klarer äußern können; wer sich mit der Endphase des sogenannten Dritten Reiches auch nur ansatzweise beschäftigt hat, weiß, dass damals junge Männer auch ohne ihren Willen zur Waffen-SS eingezogen wurden.) Aber es gab eine Zeit, da konnte man stolz darauf sein, im selben Land zu leben wie Günter Grass.
Während einer Leipziger Buchmesse ergab es sich einmal, dass ich im selben Kellerlokal wie der Autor saß. Sein Tisch war hinter mir; wäre ich mit dem Stuhl zwei Meter nach hinten gerutscht, hätte ich ihn rammen können. Er redete gar nicht viel, er rauchte Pfeife – damals durfte man noch in Lokalen rauchen – und hatte eine gewisse Präsenz: Jeder im Raum bekam mit, dass »der Grass« im Raum war. Das war durchaus beeindruckend.
Ich bin mir nicht sicher, ob er der Bundesrepublik Deutschland »fehlen« wird, wie manche schon wieder schreiben. Seine wichtige Zeit war in den 60er- und 70er-Jahren, in den vergangenen Jahren rutschte er aus dem kollektiven Gedächtnis.
Grass war ein wichtiger Autor, der zu seiner Zeit wesentliche Einflüsse ausübte. Um das nachvollziehen zu können, muss ich dann wohl doch einmal einen Roman von ihm lesen. Das könnte spannend sein.
Am heutigen Montag ist Günter Grass gestorben, der Literaturnobelpreisträger wurde 87 Jahre alt. Auch wenn ich sein literarisches Werk praktisch nicht kenne und sein künstlerisches Werk eher seltsam finde (diese Krakelbilder ...), finde ich das in gewisser Weise traurig.
Zumindest zeitweise war der Mann eine »moralische Institution« in diesem Land, bis er vor einigen Jahren mit diesem Israel-Text und seinen merkwürdigen Ausflüchten zur SS-Mitgliedschaft zu Recht in Misskredit geriet. (Zur SS hätte er sich klarer äußern können; wer sich mit der Endphase des sogenannten Dritten Reiches auch nur ansatzweise beschäftigt hat, weiß, dass damals junge Männer auch ohne ihren Willen zur Waffen-SS eingezogen wurden.) Aber es gab eine Zeit, da konnte man stolz darauf sein, im selben Land zu leben wie Günter Grass.
Während einer Leipziger Buchmesse ergab es sich einmal, dass ich im selben Kellerlokal wie der Autor saß. Sein Tisch war hinter mir; wäre ich mit dem Stuhl zwei Meter nach hinten gerutscht, hätte ich ihn rammen können. Er redete gar nicht viel, er rauchte Pfeife – damals durfte man noch in Lokalen rauchen – und hatte eine gewisse Präsenz: Jeder im Raum bekam mit, dass »der Grass« im Raum war. Das war durchaus beeindruckend.
Ich bin mir nicht sicher, ob er der Bundesrepublik Deutschland »fehlen« wird, wie manche schon wieder schreiben. Seine wichtige Zeit war in den 60er- und 70er-Jahren, in den vergangenen Jahren rutschte er aus dem kollektiven Gedächtnis.
Grass war ein wichtiger Autor, der zu seiner Zeit wesentliche Einflüsse ausübte. Um das nachvollziehen zu können, muss ich dann wohl doch einmal einen Roman von ihm lesen. Das könnte spannend sein.
12 April 2015
Kompletter Unfug, toll gemacht
Es klingt nach einer guten Idee für einen großen Film: Weil sich die Menschheit wie ein Virus über die Erde ausgebreitet hat, entwickelt ein Milliardär einen bizarren Plan – er möchte mithilfe moderner Technik einige Milliarden Menschen töten, um so der Überbevölkerung endlich Herr zu werden. Nur die »Auserwählten« können dem Armageddon entkommen, weil sie mithilfe einer riesigen Fluchtburg sicher sind.
Es klingt auch nach einer guten Idee für einen Agentenfilm à la »James Bond«, den man ein wenig durch den Kakao ziehen kann: Ausgerechnet der »Kingsman«, eine exklusive Herrenschneiderei in der Londoner City, beherbergt einen unglaublichen geheimen Geheimdienst, dessen Angehörige sich nach den Rittern der Tafelrunde benennen, nach Lancelot und Parcival beispielsweise.
Ja – ich habe jetzt endlich den Film »Kingsman – The Secret Service« gesehen. Er entstand nach dem Comic »The Secret Service«, den der Autor Mark Millar und der Zeichner Dave Gibbons veröffentlichten. Mit einem ordentlichen Etat, vielen Spezialeffekten und guten Schauspielern wurde der Comic in einen knalligen Film umgewandelt, der von der Machart her wirklich überzeugte und der nie langweilte.
Nur kann ich »Kingsman« beim besten Willen nicht empfehlen. Die offensichtliche Brutalität, die hier spielerisch inszeniert wird (Köpfe explodieren im Takt klassischer Musik, um ein Beispiel zu nennen), ist im Comic irgendwie skurril und witzig; im Film war's mir zu derb und zu überzogen.
Klar: Das ist eine Parodie. Und da gehört dazu, dass man alle »James Bond«-Klischees völlig überdreht und überzeichnet. Aber mir war's dann doch zu arg. Mag sein, dass ich ein Weichei bin. Aber der nächste Film, den ich im Kino angucke, möge ein wenig mehr Hirn aufbieten ...
Es klingt auch nach einer guten Idee für einen Agentenfilm à la »James Bond«, den man ein wenig durch den Kakao ziehen kann: Ausgerechnet der »Kingsman«, eine exklusive Herrenschneiderei in der Londoner City, beherbergt einen unglaublichen geheimen Geheimdienst, dessen Angehörige sich nach den Rittern der Tafelrunde benennen, nach Lancelot und Parcival beispielsweise.
Ja – ich habe jetzt endlich den Film »Kingsman – The Secret Service« gesehen. Er entstand nach dem Comic »The Secret Service«, den der Autor Mark Millar und der Zeichner Dave Gibbons veröffentlichten. Mit einem ordentlichen Etat, vielen Spezialeffekten und guten Schauspielern wurde der Comic in einen knalligen Film umgewandelt, der von der Machart her wirklich überzeugte und der nie langweilte.
Nur kann ich »Kingsman« beim besten Willen nicht empfehlen. Die offensichtliche Brutalität, die hier spielerisch inszeniert wird (Köpfe explodieren im Takt klassischer Musik, um ein Beispiel zu nennen), ist im Comic irgendwie skurril und witzig; im Film war's mir zu derb und zu überzogen.
Klar: Das ist eine Parodie. Und da gehört dazu, dass man alle »James Bond«-Klischees völlig überdreht und überzeichnet. Aber mir war's dann doch zu arg. Mag sein, dass ich ein Weichei bin. Aber der nächste Film, den ich im Kino angucke, möge ein wenig mehr Hirn aufbieten ...
11 April 2015
Alternative Verlierer
 Die Gee Strings sind eine der Band, deren Musik überhaupt nicht zu altern scheint. Seit die Band aus Aachen und Umgebung in den 90er-Jahren damit anfing, ihre Version von Punkrock zu spielen, die schon damals eigentlich überholt erschien, gibt es kaum Ermüdungserscheinungen. Ich habe dieser Tage ein Frühwerk der Band angehört, die Langspielplatte »Alternative Losers«, die 1999 veröffentlicht wurde.
Die Gee Strings sind eine der Band, deren Musik überhaupt nicht zu altern scheint. Seit die Band aus Aachen und Umgebung in den 90er-Jahren damit anfing, ihre Version von Punkrock zu spielen, die schon damals eigentlich überholt erschien, gibt es kaum Ermüdungserscheinungen. Ich habe dieser Tage ein Frühwerk der Band angehört, die Langspielplatte »Alternative Losers«, die 1999 veröffentlicht wurde.Die Platte enthält zehn Stücke, die vor allem durch den charakteristischen Frauengesang dominiert werden, die aber auch sonst überzeugen: rotzig-schneller Punkrock, der schwer nach den späten 70er-Jahren klingt, aber mit den Mitteln der 90er-Jahre gespielt und aufgenommen worden ist. Die Melodien sind schmissig, die Stimme klingt durchgehend rotzig, und wer Stücke wie »Wanna Buy A Boyfriend« macht, hat sowieso augenzwinkernden Humor aufzuweisen.
Immer noch super!
10 April 2015
Vom Leid der Historiker
Wieder einmal geht es in der Öffentlichkeit um die angeblichen Tabus, die sich um das Ende des Zweiten Weltkriegs ranken. Nachdem vor einigen Jahren das Tabu des Bombenkriegs »gebrochen« wurde – endlich durfte man wieder über das Bombardement auf deutsche Städte sprechen –, geht es jetzt um die Zivilbevölkerung im Allgemeinen.
Der Historiker Florian Huber hat beispielsweise das Buch »Kind, versprich mir, dass du dich erschießt« veröffentlicht, in dem es unter anderem um die Massenselbstmorde gegen Kriegsende geht. In einem Interview mit dem »Börsenblatt« wird er folgendes gefragt:
»Das Leid der Zivilbevölkerung war lange Zeit kein Thema, durfte es nicht sein, wegen der großen Schuld der Deutschen. Brauchte es 70 Jahre, um über diese Selbstmorde sprechen zu können?«
Der Autor antwortet, dass diese Tatsache »nie in das Bewusstsein der Deutschen vorgedrungen« sei. Und das verstehe ich nicht. Ich wuchs mit Geschichten über den Zweiten Weltkrieg auf. Geschichten über deutsche Opfer wohlgemerkt.
Es gab kein Familientreffen und kein Dorffest, an dem solche Dinge nicht diskutiert wurden. Ich erfuhr als Kind, wie »die Neger« in Freudenstadt gewütet hatten; meine Großtante erzählte mir, wie ihr Mann »bei de Franzose« verhungert sei; ein Großonkel war in Stalingrad geblieben. Und nicht nur einmal hörte ich, dass man sogar im beschaulichen Dietersweiler gesehen hätte, als Pforzheim lichterloh brannte.
Dasselbe Bild bietet sich übrigens – jenseits aller subjektiven Erinnerungen –, wenn man in Bücher aus den 60er- oder 70er-Jahren blickt. Seitenweise wird über die Vergewaltigungen deutscher Frauen und den Bombenkrieg geschrieben, während man beispielsweise den Massenmord an den Juden eher »am Rande« behandelte.
Wie angesichts der andauernden Berichte über das Kriegsende, über Vergewaltigungen, Bombenkrieg und Selbstmorde heute behauptet werden kann, es handle sich um Tabus, die unbedingt gebrochen werden müssten, verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich in einem anderen Land aufgewachsen und habe andere Bücher gelesen als so mancher Historiker.
Der Historiker Florian Huber hat beispielsweise das Buch »Kind, versprich mir, dass du dich erschießt« veröffentlicht, in dem es unter anderem um die Massenselbstmorde gegen Kriegsende geht. In einem Interview mit dem »Börsenblatt« wird er folgendes gefragt:
»Das Leid der Zivilbevölkerung war lange Zeit kein Thema, durfte es nicht sein, wegen der großen Schuld der Deutschen. Brauchte es 70 Jahre, um über diese Selbstmorde sprechen zu können?«
Der Autor antwortet, dass diese Tatsache »nie in das Bewusstsein der Deutschen vorgedrungen« sei. Und das verstehe ich nicht. Ich wuchs mit Geschichten über den Zweiten Weltkrieg auf. Geschichten über deutsche Opfer wohlgemerkt.
Es gab kein Familientreffen und kein Dorffest, an dem solche Dinge nicht diskutiert wurden. Ich erfuhr als Kind, wie »die Neger« in Freudenstadt gewütet hatten; meine Großtante erzählte mir, wie ihr Mann »bei de Franzose« verhungert sei; ein Großonkel war in Stalingrad geblieben. Und nicht nur einmal hörte ich, dass man sogar im beschaulichen Dietersweiler gesehen hätte, als Pforzheim lichterloh brannte.
Dasselbe Bild bietet sich übrigens – jenseits aller subjektiven Erinnerungen –, wenn man in Bücher aus den 60er- oder 70er-Jahren blickt. Seitenweise wird über die Vergewaltigungen deutscher Frauen und den Bombenkrieg geschrieben, während man beispielsweise den Massenmord an den Juden eher »am Rande« behandelte.
Wie angesichts der andauernden Berichte über das Kriegsende, über Vergewaltigungen, Bombenkrieg und Selbstmorde heute behauptet werden kann, es handle sich um Tabus, die unbedingt gebrochen werden müssten, verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich in einem anderen Land aufgewachsen und habe andere Bücher gelesen als so mancher Historiker.
09 April 2015
Ein Horror-Gnom im Hörspiel
 Wann immer ich eines der Hörspiele aus der Serie »John Sinclair Classics« höre, bin ich positiv überrascht: Die ursprünglichen Geschichten sind altmodisch, sie sind manchmal von der Idee her arg plump – aber die Hörspiele unterhalten sehr gut und machen echt Spaß. Ein schönes Beispiel dafür ist »Der Gnom mit den Krallenhänden«.
Wann immer ich eines der Hörspiele aus der Serie »John Sinclair Classics« höre, bin ich positiv überrascht: Die ursprünglichen Geschichten sind altmodisch, sie sind manchmal von der Idee her arg plump – aber die Hörspiele unterhalten sehr gut und machen echt Spaß. Ein schönes Beispiel dafür ist »Der Gnom mit den Krallenhänden«.Im Original erschien der Roman bereits 1974 in der Reihe der Gespenster-Krimis. Die Hörspielfassung ist von 2013 und wurde von Zaubermond für Lübbe Audio produziert. Dank des spannenden Drehbuches, der hervorragenden Sprecher und des wuchtigen Sounddesigns packte mich die Handlung, und ich fand das gesamte Hörspiel echt spannend.
Zu einem großen Teil spielt die Handlung in Frankreich, in einem Dorf in der Normandie. Dort wurde vor 300 Jahr ein Magier mit der Axt hingerichtet, dort starb vor dreißig Jahren ein Ehepaar bei einem Brand nach Blitzeinschlag, und dorthin muss der Inspektor John Sinclair irgendwann reisen. Der Magier, der vor 300 Jahren gestorben ist, scheint wieder da zu sein und sein Unwesen zu treiben, und aus London wurde mitten aus einer Zauberer-Veranstaltung eine junge Frau entführt ...
Über Handlungslogik darf man bei solchen Geschichten nicht immer nachdenken, sonst erträgt man es nicht. Aber die Kämpfe in der Mühle – inklusive der Blutspritzerei –, die Auseinandersetzung des britischen Polizisten mit den französischen Dörflern, die Szenerie im Theater ... das alles ist mithilfe der Geräusche so gut umgesetzt, dass man als Hörer gern der Geschichte folgt.
Gelegentlich spielt das Hörspiel sogar ironisch mit den britisch-französischen Gegensätzen; leider wird dieses Potenzial nicht ausgereizt. Letztlich könnte die Geschichte überall spielen, und das ist schade.
Was bleibt, ist ein Hörspiel, das tatsächlich Grusel und Action verbreitet. Was an der Handlung nicht stimmig ist, würde mich bei einer Lektüre sicher stören; in diesem Medium fällt es einfach nicht zu sehr auf. Schön gemacht!
08 April 2015
Herr Fruk bei den Missionaren
Als »Fruk« wurde ich schlichtweg eingetragen; in der Procure Generale des Missions Catholiques nahm man es mit der Exaktheit nicht so genau. Ich übernachtete dort im November 1999, und die »Participation aux Frais de Sejour« verzeichnet ein Nacht in einem Ein-Bett-Zimmer sowie ein kleines Frühstück.
Es war mein bevorzugtes Lokal in Douala, der Hauptstadt von Kamerun. Die Zimmer waren sauber, ich hatte Zugang zu einem großzügigen Balkon, wo ich unter dem Dach von der mörderischen Sonne geschützt war. Es war brüllend warm, die Luft brodelte geradezu, und vom Fluss her waberte rund um die Uhr die feuchte Luft.
In meinem Zimmer machte die Klimaanlage einen fürchterlichen Lärm, aber ich schlief hervorragend, weil man es so einigermaßen aushalten konnte. Die Priester und Mönche in der Katholischen Mission waren nett und ließen mich in Ruhe. Bei ihren Gebeten und Gottesdiensten durfte man sie allerdings nicht stören.
Ich verbrachte geruhsame und auch schöne Tage bei den Katholiken. Von ihrem Haus aus hatte ich eine gute Möglichkeit, die Stadt zu Fuß zu erlaufen. Straßenimbisse, Restaurants, ein illegaler Geldwechsler und eine Bushhaltestelle waren um die Ecke; unweit der Mission war eine große Straße mit reichhaltigem Verkehr.
Und schaue ich mir heute die Rechnung an, die ich von den Missionaren erhalten habe, kommen lauter Geschichten in mir hoch. Irgendwann, so nehme ich mir in solchen Fällen vor, werde ich diese alle schreiben.
Es war mein bevorzugtes Lokal in Douala, der Hauptstadt von Kamerun. Die Zimmer waren sauber, ich hatte Zugang zu einem großzügigen Balkon, wo ich unter dem Dach von der mörderischen Sonne geschützt war. Es war brüllend warm, die Luft brodelte geradezu, und vom Fluss her waberte rund um die Uhr die feuchte Luft.
In meinem Zimmer machte die Klimaanlage einen fürchterlichen Lärm, aber ich schlief hervorragend, weil man es so einigermaßen aushalten konnte. Die Priester und Mönche in der Katholischen Mission waren nett und ließen mich in Ruhe. Bei ihren Gebeten und Gottesdiensten durfte man sie allerdings nicht stören.
Ich verbrachte geruhsame und auch schöne Tage bei den Katholiken. Von ihrem Haus aus hatte ich eine gute Möglichkeit, die Stadt zu Fuß zu erlaufen. Straßenimbisse, Restaurants, ein illegaler Geldwechsler und eine Bushhaltestelle waren um die Ecke; unweit der Mission war eine große Straße mit reichhaltigem Verkehr.
Und schaue ich mir heute die Rechnung an, die ich von den Missionaren erhalten habe, kommen lauter Geschichten in mir hoch. Irgendwann, so nehme ich mir in solchen Fällen vor, werde ich diese alle schreiben.
07 April 2015
Guttermouth und der Musikalische Affe
Es gab eine Zeit, sie muss anfangs der 90er-Jahre gewesen sein, als ich die meisten der sogenannten MelodyCore-Bands richtig gern hörte. Ich kaufte mir Platten von Bands, bei denen vor allem wichtig war, dass sie aus Kalifornien kamen und hochmelodischen Punk oder Hardcore spielten. Wenige Jahre später nervte das derart, dass ich jahrelang einen großen Bogen um alles machte, was auch nur ansatzweise nach MelodyCore roch.
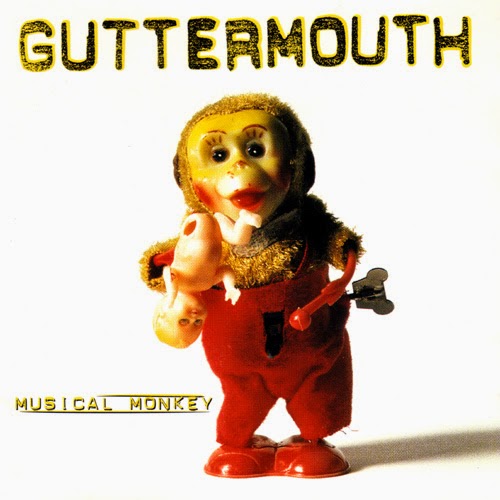 Was für ein Fehler das eigentlich war und ist, merke ich, wenn ich mit dem Abstand von vielen Jahren eine Platte wie die »Musical Monkey« von Guttermouth anhöre. Die Band kommt aus Huntington Beach – grob gesagt liegt das zwischen Los Angeles und San Diego – und ist seit Ende der 80er-Jahre aktiv. Die genannte Platte war die vierte der Band und wurde 1997 veröffentlicht.
Was für ein Fehler das eigentlich war und ist, merke ich, wenn ich mit dem Abstand von vielen Jahren eine Platte wie die »Musical Monkey« von Guttermouth anhöre. Die Band kommt aus Huntington Beach – grob gesagt liegt das zwischen Los Angeles und San Diego – und ist seit Ende der 80er-Jahre aktiv. Die genannte Platte war die vierte der Band und wurde 1997 veröffentlicht.
Was Guttermouth hier in 15 kurzen und vor allem auch kurzweiligen Stücken servieren, ist rotziger Punkrock mit viel Melodie, einer gelegenlich metallisch sägenden Gitarre und einem angenehm klingenden Sänger, der nicht übertrieben über die Stücke gemischt wird. Das Tempo ist mal hektisch, zwischendurch wird aber fast schon geschunkelt – man gibt sich redlich Mühe, Abwechslung in die Stücke zu bringen.
Und textlich? Die Band ist oftmals sarkastisch; sie setzt sich kritisch mit Auswüchsen der Punk-Szene auseinander oder singt über den »American Way Of Life«, etwa in Zeilen wie »God Bless America Home Of The Woppers«. Das ist alles ziemlich klasse, und die Texte sind ein Beleg dafür, dass flotte Musik manchmal auch schlaue Texte verbergen kann.
Eine echt positive Platte, die mich nach all den Jahren richtig überrascht hat. Wer mal was von der Band hören möchte, sollte sich den »Musical Monkey« vormerken; unterhaltsam und gelungen ist das allemal.
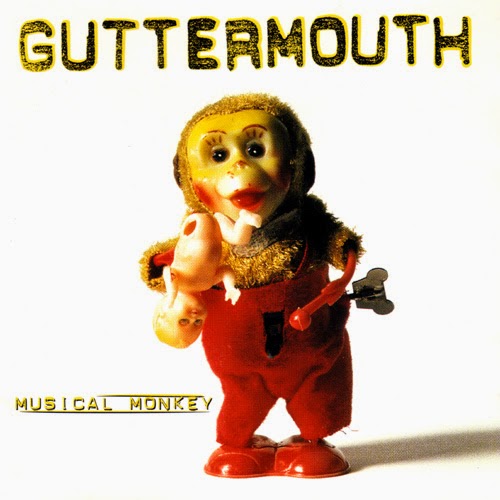 Was für ein Fehler das eigentlich war und ist, merke ich, wenn ich mit dem Abstand von vielen Jahren eine Platte wie die »Musical Monkey« von Guttermouth anhöre. Die Band kommt aus Huntington Beach – grob gesagt liegt das zwischen Los Angeles und San Diego – und ist seit Ende der 80er-Jahre aktiv. Die genannte Platte war die vierte der Band und wurde 1997 veröffentlicht.
Was für ein Fehler das eigentlich war und ist, merke ich, wenn ich mit dem Abstand von vielen Jahren eine Platte wie die »Musical Monkey« von Guttermouth anhöre. Die Band kommt aus Huntington Beach – grob gesagt liegt das zwischen Los Angeles und San Diego – und ist seit Ende der 80er-Jahre aktiv. Die genannte Platte war die vierte der Band und wurde 1997 veröffentlicht.Was Guttermouth hier in 15 kurzen und vor allem auch kurzweiligen Stücken servieren, ist rotziger Punkrock mit viel Melodie, einer gelegenlich metallisch sägenden Gitarre und einem angenehm klingenden Sänger, der nicht übertrieben über die Stücke gemischt wird. Das Tempo ist mal hektisch, zwischendurch wird aber fast schon geschunkelt – man gibt sich redlich Mühe, Abwechslung in die Stücke zu bringen.
Und textlich? Die Band ist oftmals sarkastisch; sie setzt sich kritisch mit Auswüchsen der Punk-Szene auseinander oder singt über den »American Way Of Life«, etwa in Zeilen wie »God Bless America Home Of The Woppers«. Das ist alles ziemlich klasse, und die Texte sind ein Beleg dafür, dass flotte Musik manchmal auch schlaue Texte verbergen kann.
Eine echt positive Platte, die mich nach all den Jahren richtig überrascht hat. Wer mal was von der Band hören möchte, sollte sich den »Musical Monkey« vormerken; unterhaltsam und gelungen ist das allemal.
04 April 2015
Lieblingsbuchhandlung im Norden
Wenn mich eine Dienst- oder Privatreise nach Hamburg führt, versuche ich es immer einzurichten, dass ich eine ganz bestimmte Buchhandlung besuche. Oft klappt es, und nie verlasse ich das Geschäft, ohne ein neues Buch gekauft zu haben. Die Rede ist von der Buchhandlung Felix Jud; sie liegt beim Jungfernstieg »um die Ecke« und damit mitten im schicksten Teil der Hansestadt.
Was bei manchem anderen Geschäft ein echter Nachteil ist, weil es zu snobistisch wirken könnte, schadet bei dieser Buchhandlung nicht. Eher ist der Einfluss durch die großbürgerliche Umgebung ein positiver: Es fehlt an den Bergen von schlecht geschriebenen und schlecht verarbeiteten Büchern, die andere Buchhandlungen geradezu verstopfen.
Bei diesem Geschäft ist der Stil irgendwie positiv. Es beginnt bei der schönen Architektur – das Geschäft verläuft auf zwei schmalen Etagen, und Regale erstrecken sich entlang der Treppen – und endet bei der Auswahl der Sachbücher, der Romane, der Klassiker, des Antiquariats und der schönen Kinderbuch-Abteilung. Alles wirkt, als sei es mit viel Herz und Verstand ausgesucht worden; hier waren eindeutig Leute am Werk, die etwas von Literatur verstehen und das auch vermitteln wollen.
Das Personal ist zurückhaltend; man kann nach Herzenslust stöbern. Und wer eine Frage hat – was ich schon oft genug mitbekam –, bekommt eine fachkundige Antwort. Bei dieser Buchhandlung bin ich einfach gern Kunde, und ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch in Hamburg.
Was bei manchem anderen Geschäft ein echter Nachteil ist, weil es zu snobistisch wirken könnte, schadet bei dieser Buchhandlung nicht. Eher ist der Einfluss durch die großbürgerliche Umgebung ein positiver: Es fehlt an den Bergen von schlecht geschriebenen und schlecht verarbeiteten Büchern, die andere Buchhandlungen geradezu verstopfen.
Bei diesem Geschäft ist der Stil irgendwie positiv. Es beginnt bei der schönen Architektur – das Geschäft verläuft auf zwei schmalen Etagen, und Regale erstrecken sich entlang der Treppen – und endet bei der Auswahl der Sachbücher, der Romane, der Klassiker, des Antiquariats und der schönen Kinderbuch-Abteilung. Alles wirkt, als sei es mit viel Herz und Verstand ausgesucht worden; hier waren eindeutig Leute am Werk, die etwas von Literatur verstehen und das auch vermitteln wollen.
Das Personal ist zurückhaltend; man kann nach Herzenslust stöbern. Und wer eine Frage hat – was ich schon oft genug mitbekam –, bekommt eine fachkundige Antwort. Bei dieser Buchhandlung bin ich einfach gern Kunde, und ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch in Hamburg.
03 April 2015
Sardev und die Aussprachen
Dass ich mich darüber freue, weil mein Kurzroman »Schatten des Friedens« jetzt auch als E-Book herauskommt, habe ich ja schon gelegentlich ausgeplaudert. Der Verlag In Farbe Und Bunt hat dazu jetzt auch ein Hörbuchprojekt in Arbeit, worauf ich mich ebenfalls freue. Ich meine ... ein Text von mir als Hörbuch, das ist doch was!
Womit ich natürlich nicht gerechnet habe, sind Fragen nach der Aussprache. Wie zum Teufel sprechen sich manche »meiner« Figuren an? Ich stelle fest, dass ich mir das alles schön ausgedacht, aber nie verschriftlicht habe.
Das steht mir jetzt bevor: Damit der Sprecher weiß, was er zu tun hat, müssen wir wohl miteinander allerlei Sprechübungen machen. Das finde ich witzig – in über dreißig Berufsjahren als Schreiberling hatte ich das noch nicht. Immer wieder neue Erfahrungen ...
Womit ich natürlich nicht gerechnet habe, sind Fragen nach der Aussprache. Wie zum Teufel sprechen sich manche »meiner« Figuren an? Ich stelle fest, dass ich mir das alles schön ausgedacht, aber nie verschriftlicht habe.
Das steht mir jetzt bevor: Damit der Sprecher weiß, was er zu tun hat, müssen wir wohl miteinander allerlei Sprechübungen machen. Das finde ich witzig – in über dreißig Berufsjahren als Schreiberling hatte ich das noch nicht. Immer wieder neue Erfahrungen ...
02 April 2015
Von Kornfeldern und Schlagern
»Mach die sexistische Scheiße aus!«, keifte die Frau mit den kurzen, rötlich gefärbten Haaren. Sie zeigte mit dem Finger auf den Cassetten-Recorder, der auf einem Stuhl stand.
Es war anfangs der 90er-Jahre, und wir saßen in Heidelberg in meiner liebsten Punkrock-WG. Normalerweise lief krachige Musik, oftmals Deutschpunk, gern Hardcore. An diesem Abend aber dröhnte »Ein Bett im Kornfeld« aus den scheppernden Boxen.
Wir tranken Bier und redeten dummes Zeugs, unsere Haare standen in alle Richtungen. Die Musik passte nicht unbedingt dazu, und das hatte wenig mit den Texten zu tun.
Im Verlauf des vergangenen Halbjahres war das Interesse von immer mehr Leuten an der alten Schlagermusik gewachsen. Woran das genau lag, wusste keiner so recht; aber ausgerechnet die Leute, die ansonsten Deutschpunk oder Hardcore bevorzugten, hörten neuerdings gern Schlager. Und im Autonomen Zentrum in Heidelberg vertrugen sich bei den Disco-Abenden die Dead Kennedys wunderbar mit Dschingis Khan.
Aber Jürgen Drews, das ging wohl doch nicht. Die Auseinandersetzung war kurz und nervig. Wir blieben hart, das Lied lief weiter. Die junge Frau blieb auch hart, sie ging. Letztlich hatte Jürgen Drews gesiegt.
Und das gilt wohl generell: Heute wird der Mann siebzig Jahre alt. Er ist nicht das, was man als einen anerkannten Künstler bezeichnen würde. Aber jeder weiß, wer Jürgen Drews ist, jeder kennt Klassiker wie das eben erwähnte »Ein Bett im Kornfeld«, und mit alledem ist der Mann auch noch erfolgreich.
Ich finde Schlager doof, und ich kann nicht einmal mehr – wie anfangs der 90er-Jahre – mit viel Ironie an die Klassiker dieser Musikrichtung herantreten. Jürgen Drews hat sich seinen Erfolg erarbeitet, man muss ihn nicht mögen, aber für den Elan, mit dem er alles durchzieht, bewundere ich ihn geradezu. Da gratuliere ich voller Ernst!
Es war anfangs der 90er-Jahre, und wir saßen in Heidelberg in meiner liebsten Punkrock-WG. Normalerweise lief krachige Musik, oftmals Deutschpunk, gern Hardcore. An diesem Abend aber dröhnte »Ein Bett im Kornfeld« aus den scheppernden Boxen.
Wir tranken Bier und redeten dummes Zeugs, unsere Haare standen in alle Richtungen. Die Musik passte nicht unbedingt dazu, und das hatte wenig mit den Texten zu tun.
Im Verlauf des vergangenen Halbjahres war das Interesse von immer mehr Leuten an der alten Schlagermusik gewachsen. Woran das genau lag, wusste keiner so recht; aber ausgerechnet die Leute, die ansonsten Deutschpunk oder Hardcore bevorzugten, hörten neuerdings gern Schlager. Und im Autonomen Zentrum in Heidelberg vertrugen sich bei den Disco-Abenden die Dead Kennedys wunderbar mit Dschingis Khan.
Aber Jürgen Drews, das ging wohl doch nicht. Die Auseinandersetzung war kurz und nervig. Wir blieben hart, das Lied lief weiter. Die junge Frau blieb auch hart, sie ging. Letztlich hatte Jürgen Drews gesiegt.
Und das gilt wohl generell: Heute wird der Mann siebzig Jahre alt. Er ist nicht das, was man als einen anerkannten Künstler bezeichnen würde. Aber jeder weiß, wer Jürgen Drews ist, jeder kennt Klassiker wie das eben erwähnte »Ein Bett im Kornfeld«, und mit alledem ist der Mann auch noch erfolgreich.
Ich finde Schlager doof, und ich kann nicht einmal mehr – wie anfangs der 90er-Jahre – mit viel Ironie an die Klassiker dieser Musikrichtung herantreten. Jürgen Drews hat sich seinen Erfolg erarbeitet, man muss ihn nicht mögen, aber für den Elan, mit dem er alles durchzieht, bewundere ich ihn geradezu. Da gratuliere ich voller Ernst!
01 April 2015
Farbenprächtiger Blick auf den Anfang des 20. Jahrhunderts
Andrea Camilleri ist einer jener italienischen Autoren, die ich in den vergangenen Jahren zu schätzen gelernt habe. Nicht unbedingt wegen seiner unterhaltsamen, unterm Strich aber manchmal gar zu »fluffigen« Krimis um den eigenwilligen Commissario Montalbano, sondern eher wegen seiner Romane der allgemeinen Art.
Zu diesen zählt »Die Sekte der Engel«, der auf historischen Quellen basiert, aber in seinen inhaltlichen Aussagen sehr wohl viel mit der heutigen Zeit zu tun hat. Was wie eine Provinz-Schnurre anfängt, die das Leben im Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts widerspiegelt, wird zu einem packenden Krimi und zuletzt zu einer Darstellung der Mafia-Gesellschaft, wie sie bis heute in weiten Teilen des Landes existiert.
Die Handlung spielt im Jahr 1901 in der sizilianischen Kleinstadt Palizzolo. Es gibt für die 7000 Einwohner tatsächlich sieben Kirchen, die sich streng nach den alten Herrschaften ausrichten. Das Volk hat nichts zu melden, nach wie vor regeln irgendwelche »Dons« alles; es gibt aber bereits einen Mafioso im Ort, über den niemand öffentlich spricht, von dem aber jeder weiß.
 Ein links stehender Anwalt, der sich für die Rechte der Arbeiter einsetzt, wird von den Priestern in den Kirchen öffentlich angegriffen; ansonsten sind die Strukturen eher mittelalterlich als neuzeitlich. Als sich nach einigem Wirrwarr herausstellt, dass mehrere junge Frauen – allesamt sehr fromm – auf einmal schwanger sind, kann dahinter entweder nur der Teufel oder eben der Heilige Geist stecken ...
Ein links stehender Anwalt, der sich für die Rechte der Arbeiter einsetzt, wird von den Priestern in den Kirchen öffentlich angegriffen; ansonsten sind die Strukturen eher mittelalterlich als neuzeitlich. Als sich nach einigem Wirrwarr herausstellt, dass mehrere junge Frauen – allesamt sehr fromm – auf einmal schwanger sind, kann dahinter entweder nur der Teufel oder eben der Heilige Geist stecken ...
Anfangs ist der Roman einerseits komplex – wegen der vielen Namen, Titel und Verbindungen –, anderseits eher witzig. Wer als Leser den Einstieg geschafft hat, taucht staunend ein in eine Welt voller Intrigen und Heimtücke, in der missbrauchte junge Frau ebensowenig zu melden haben wie ein Anwalt, der für Recht und Gesetz eintritt.
Man folgt als Leser dem Geschehen mit Spannung und Ekel zugleich, ist gefesselt und abgestoßen ... und weiß hinterher echt auf spielerische Weise mehr über Italien im Allgemeinen und Sizilien im Besonderen.
Ein toller Roman, den ich als Hardcover-Ausgabe gelesen habe. Das gebundene Buch schmückt jedes Bücherregal, aber es gibt das Werk sicher ebenso als E-Book. Und wer ein wenig mehr wissen möchte, kann sich ja die Leseprobe reinziehen ...
Zu diesen zählt »Die Sekte der Engel«, der auf historischen Quellen basiert, aber in seinen inhaltlichen Aussagen sehr wohl viel mit der heutigen Zeit zu tun hat. Was wie eine Provinz-Schnurre anfängt, die das Leben im Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts widerspiegelt, wird zu einem packenden Krimi und zuletzt zu einer Darstellung der Mafia-Gesellschaft, wie sie bis heute in weiten Teilen des Landes existiert.
Die Handlung spielt im Jahr 1901 in der sizilianischen Kleinstadt Palizzolo. Es gibt für die 7000 Einwohner tatsächlich sieben Kirchen, die sich streng nach den alten Herrschaften ausrichten. Das Volk hat nichts zu melden, nach wie vor regeln irgendwelche »Dons« alles; es gibt aber bereits einen Mafioso im Ort, über den niemand öffentlich spricht, von dem aber jeder weiß.
 Ein links stehender Anwalt, der sich für die Rechte der Arbeiter einsetzt, wird von den Priestern in den Kirchen öffentlich angegriffen; ansonsten sind die Strukturen eher mittelalterlich als neuzeitlich. Als sich nach einigem Wirrwarr herausstellt, dass mehrere junge Frauen – allesamt sehr fromm – auf einmal schwanger sind, kann dahinter entweder nur der Teufel oder eben der Heilige Geist stecken ...
Ein links stehender Anwalt, der sich für die Rechte der Arbeiter einsetzt, wird von den Priestern in den Kirchen öffentlich angegriffen; ansonsten sind die Strukturen eher mittelalterlich als neuzeitlich. Als sich nach einigem Wirrwarr herausstellt, dass mehrere junge Frauen – allesamt sehr fromm – auf einmal schwanger sind, kann dahinter entweder nur der Teufel oder eben der Heilige Geist stecken ...Anfangs ist der Roman einerseits komplex – wegen der vielen Namen, Titel und Verbindungen –, anderseits eher witzig. Wer als Leser den Einstieg geschafft hat, taucht staunend ein in eine Welt voller Intrigen und Heimtücke, in der missbrauchte junge Frau ebensowenig zu melden haben wie ein Anwalt, der für Recht und Gesetz eintritt.
Man folgt als Leser dem Geschehen mit Spannung und Ekel zugleich, ist gefesselt und abgestoßen ... und weiß hinterher echt auf spielerische Weise mehr über Italien im Allgemeinen und Sizilien im Besonderen.
Ein toller Roman, den ich als Hardcover-Ausgabe gelesen habe. Das gebundene Buch schmückt jedes Bücherregal, aber es gibt das Werk sicher ebenso als E-Book. Und wer ein wenig mehr wissen möchte, kann sich ja die Leseprobe reinziehen ...
Abonnieren
Kommentare (Atom)
