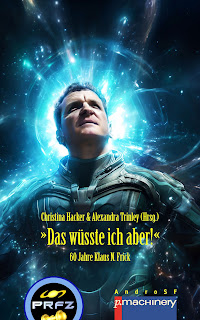Die »Aldebaran« ist ein Schiff, »gestrandet« in Marseille. Aus rechtlichen Gründen darf es nicht weiterfahren, die Besatzung wird entlassen und kann nach Hause. Doch zwei Männer bleiben an Bord: der libanesische Kapitän und der griechische Erste Offizier; später gesellt sich noch der türkische Funker dazu. Zwischen dem rostigen Rumpf des Schiffes und den Straßen von Marseille finden sie alle ihr Schicksal, mal tragisch, mal positiv.
Jean Claude Izzo wurde vor allem durch seine »Marseille-Trilogie« bekannt, für die er auch Literaturpreise bekam. Mit »Aldebaran« legte er Ende der 90er-Jahre ein Spätwerk vor, das ich endlich gelesen habe: ein packender Roman über Marseille und seine Menschen, das Mittelmeer und seine Seefahrt, weit entfernt davon, ein »normaler« Krimi zu sein, eher ein Stück faszinierender Literatur, streckenweise durchaus grob, dann aber doch voller Mitgefühl für die einzelnen Figuren.
Der Autor bleibt in seinem Roman, der sich flott lesen lässt, immer dicht an seinen Figuren dran, geht streckenweise tief in ihr Inneres hinein, wechselt dabei munter die Erzählperspektive – aber das macht er gekonnt, so dass ich damit gut klarkomme – und schafft es so, auf den vergleichsweise wenigen Seiten ein Sittenbild seiner Figuren und ihres Umfeldes zu zeichnen.
Dieses Sittenbild ist streckenweise heftig, unter anderem werden zwei Vergewaltigungen thematisiert. Sie werden nicht ausführlich geschildert, aber sie sind eindeutig genug.
Auf der anderen Seite schreibt der Autor immer wieder über die Liebe. Der Kapitän verzehrt sich nach seiner Frau, die er zurückgelassen hat und zu der er wohl nie zurückkehren wird. Die Ehe des Ersten Offiziers ist bereits zerbrochen, und in Marseille will er eine alte Liebe wiederfinden. Und der junge Funker, der nicht weiß, wohin er mit seinen Gefühlen soll, lässt sich in einer wirren Verliebtheit auf dumme und gefährliche Dinge ein.
Alles in allem ist »Aldebaran« ein sehr dicht erzählter Roman, der streckenweise zwar ein wenig grob ist, ansonsten aber die großen Gefühle ins Zentrum stellt und eine Stadt porträtiert. Ich fand ihn klasse.
(Erschienen ist er im Unionsverlag. Ich habe die Hardcover-Version, die schon vergriffen ist; es gibt ihn aber als Taschenbuch sowie als E-Book.)